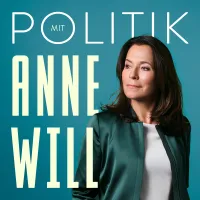Episode Transcript
Wir steigen gewohnt positiv ein.
Was an Ihrer Arbeit als sogenannte Wirtschaftsweise macht Ihnen verlässlich schlehte Laune?
Wenn ich gefragt werde, Wirtschaftsweise, was ist das denn?
Und sind Sie wirklich so weise?
Am Anfang hat mich dieser Begriff tatsächlich gestört.
Ich denke, er macht einen auch alt und jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter.
Da gewöhn ich mich langsam ran.
Nein, das ist eigentlich inzwischen ein Markenbegriff und damit komme ich jetzt auch gut zurecht.
Aber Ja, wenn man dann so hart angegangen wird, weil man mal die Wahrheit gesagt hat, das macht einem jetzt nicht immer gute Laune.
Aber das gehört dazu, das mache ich trotzdem immer noch gerne.
Hallo und herzlich willkommen bei uns.
Freut mich total, dass ihr dabei seid, uns zuhört oder aber auch zu seht.
Das könnt ihr demnächst übrigens auch live tun, wenn ihr Lust dazu habt.
Wir gehen auf Tour.
Wir sind am ersten Oktober in Köln und da werden, das kann ich jetzt mittlerweile verraten, weil wir die festen Zusagen haben, da werden Hazel Brogger und Kevin Kühnert dabei sein, den man lange nicht gehört hat.
Und diese Kombi aus den beiden, Hazel Brogger und Kevin Kühnert, stellt mich mir wirklich superinteressante.
Vorher freue ich mich, das empfehle ich euch sehr, wie ich auch die anderen Live-Shows am achten Oktober in Hamburg, am dreizehnten Oktober in Berlin und am zwölften November in Leipzig euch sehr empfehle, wo genau und wie ihr dann an Tickets kommt.
All das findet ihr, das wisst ihr in den Show-Notes und kommt am besten alle.
Ich fände es jedenfalls richtig klasse.
Wie ich mich jetzt sehr freue, dass Monika Schnitzer bei uns ist, die Vorsitzende des Sachverständigen Rats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie die sogenannten fünf Wirtschaftsweisen im umständlichen Original heißen.
Herzlich willkommen, Frau Schnitzel.
Ja, ich freue mich auch.
Was genau stört Sie an der Bezeichnung Wirtschaftsweise so?
Weil eigentlich ist es doch cool.
Also Wirtschaftsweise klingt klasse.
wäre vielleicht noch zu übertreffen von den Großvisieren des Reiches oder irgendwie sowas.
Naja, es klingt schon ein bisschen so mittelalterlich.
Und wie gesagt, das klingt nach alten weisen Männern.
Und das bin ich nicht.
Ich bin ein bisschen älter schon, aber ich bin eine Frau.
Es war, es bin ich natürlich auch.
Aber ja, ist ein lustiger Begriff.
Wie gesagt, ich habe mich da inzwischen ganz gut mit angefreundet, weil das hat einen Wiedererkennungseffekt.
Wenn ich sage, einfach nur Sachverständigrate, ja, es gibt viele Sachverständigräte.
Und wenn man dann noch dazu sagt, Sie haben es ja eben genau ausdifferenziert.
Der solch verständigen Rat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
So stellen Sie sich wahrscheinlich nicht vor.
Sagen wir jemanden, spricht sie auf der Straße und sagt, kennen Sie irgendwo her, Fernsehen?
Also, wer sind Sie noch mal?
Dann sagen Sie nicht.
Ich bin die Vorsitzende des Sachverständens.
Oder was sagen Sie?
Kommt wirklich drauf an.
Wie genau der Kontext ist.
Also, wenn ich mich jetzt offiziell vorstelle, würde ich das natürlich genauso sagen.
Aber wie gesagt, auf der Straße würde ich es ein bisschen einfacher sagen.
Wenn ich wirklich erkannt werden will, wenn ich nicht erkannt werden würde, dann sagen wir, ich weiß gar nicht, wen sie da meinen.
Wir kennen uns noch nicht, ne?
Ich will korrigieren, alte, weiße Frau, Sie sind nineteenhundertsechzig geboren.
Das ist aus meiner Sicht jedenfalls überhaupt gar nicht alt, aber stimmt es.
Es waren immer weiße, oder?
Ja, natürlich bisher.
Wir waren das tatsächlich immer weiße.
Wir haben...
auch bisher, glaube ich, niemanden, der keine deutsche Staatsbürgerschaft.
Na, bin ich jetzt nicht ganz sicher, das könnte in früherer Zeit mal der Fall gewesen sein.
Wir haben jetzt zum ersten Mal jemand, der nicht in Deutschland wohnt, sondern in den Vereinigten Staaten.
Ulrike Malmen hier, auch eine Professorin.
Auch eine Professorin, eine deutsche Professorin, die aber schon seit Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten lebt.
Ja, das macht das schon mal sehr viel diverser im Sinne von, da kommt auch immer eine...
Perspektive aus dem Ausland rein, das ist sehr spannend.
Ja, das glaube ich auch.
Das brauchen Sie für Ihre Arbeit.
Doch, wenn gleich Sie das natürlich in Ihren jeweiligen Forschungsschwerpunkten ja auch haben, dass Sie viel lesen.
Ja, klar.
Und auch viel, viel in die Geste einladen.
Ja, ich war ja auch viel dort.
Ja, aber trotzdem, also es relativiert das dann immer so ein bisschen.
Weil man denkt sich ja hier immer in Deutschland, das ist der Nabel der Welt.
Und nur was hier passiert, das ist wichtig.
Nein, also gerade momentan ist ja natürlich das, was in Vereinigten Staaten passiert.
Wichtig, sagen wir es mal so.
Auch für die Gesamtwirtschaftlich Entwicklung.
Ich bin dankbar und ich bin auch beeindruckt Frau Schnitzer, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen, denn wir zeichnen auf am zehnten September um halb neun Uhr abends und Sie haben jetzt einen ganzen Pickapackervollensitzungstag mit dem Sachverständigenrat schon hinter sich.
Das stelle ich mir fordernd vor, arbeitsreich, intensiv, da rauchen die Köpfe und ich stelle mir vor, dass vermutlich mitschwingt, dass alles oder vieles von dem, was sie aufschreiben und in dieses Jahresgutachten packen, das kennen wir alle dieses Bild, wenn das übergeben wird an die Bundesregierung, an den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, dass das alles zwar freundlich lächelnd entgegengenommen wird, aber dann mehr oder weniger in der Tonne landet.
Ist das so?
Das kann man so nicht sagen, das hängt wirklich sehr davon ab, welche Themen gerade angesprochen werden, inwiefern die gerade auch auf politische Zustimmung stoßen.
Und lustigerweise ist es eben so, je nachdem, wie man es dann vorstellt, welche Ministerium, welche Farbe das Ministerium gerade hat, also das heißt, von welcher Partei das gerade geführt wird.
kommt der eine oder andere Aspekt gut an, wenn man ins eine Ministerium geht und dann geht man ins nächste und dann sagen sie, naja, das finde ich jetzt gerade nicht so gut.
Aber den anderen Aspekt, den finde ich gut, aber mit dem Koalitionspartner können wir das gerade nicht machen.
Das ging uns in der Ampel sehr stark so.
Je nachdem war man im Finanzministerium, im Wirtschaftsministerium, im Kanzleramt, waren das drei unterschiedlich geführte Häuser.
Da kam immer unterschiedliches in den unterschiedlichen Häusern an.
Das wissen Sie aber ja.
Denken Sie darüber nach bei Ihren Beratungen, was die aktuelle Bundesregierung überhaupt aus der jeweiligen politischen Haltung heraus durchsetzen wollte, was also aus ihrer Perspektive durchsetzbar wäre oder ist in das Wurschen?
und sie sagen, nein, wir schreiben beinhart pur, streng auf, was wir wirtschaftspolitisch für geboten halten.
Also natürlich denken wir in erster Linie darüber nach, was ist denn wirtschaftspolitisch geboten?
berücksichtigen insofern die politischen Realitäten, als wir schon versuchen auch Hilfestellungen zu geben.
Mit welchen Argumenten könnte man denn das, was wir für richtig halten, auch vermitteln, den Wählerinnen und Wählern.
Das ist ja schon wichtig.
Und wenn wir später in die Wirtschaftspolitischen Fragen einsteigen, dann kann ich das suchen, auch so ein bisschen zu erläutern.
Aber haben Sie die Wählerinnen und Wähler im Blick oder müssen Sie zunächst immer die Ministerien, den jeweiligen Kanzler, die Kanzlerinnen im Blick haben?
Also geht es darum, was politisch durchsetzbar wäre oder setzen Sie dann darauf, dass Manch einer, der in der Zeitung nachgelesen hat, in einem tollen Podcast, wie unserem gehört hat, was denn die sogenannten Wirtschaftsweise, ich bleibe kurz bei dem Wort, was die aufgeschrieben haben und empfohlen haben, was davon jetzt Realität, setzen Sie auf eine politische Stimmung dann oder eher realistischerweise auf die Kräfte in der Bundesregierung, die es anpacken müssten.
Also zunächst einmal überlegen wir uns, gibt es überhaupt ein Erkenntnisproblem?
Also wenn wir denken zu einem bestimmten Punkt, das wäre jetzt die richtige Option, die man ziehen könnte oder sollte, dann überlegen wir uns erst mal, haben die das auch so verstanden oder müssen wir das erst mal erklären?
Also gibt es ein Erkenntnisproblem?
Manchmal gibt es...
Ein solches Erkenntnisproblem und dann versuchen wir wirklich zu überzeugen.
Bei der Rente gibt es zum Beispiel das Problem, wollen wir ein Aktien investieren und so sparen?
und da sind nicht alle gleichermaßen davon überzeugt.
Da versuchen wir wirklich zu überzeugen.
Und manchmal ist es so, das ist nicht ein erkenntliches Problem, aber es heißt wirklich, ja, aber mit dem Koalitionspartner geht es nicht.
Oder das können wir den Menschen schwer vermitteln.
Und dann versuchen wir zu zeigen, wo gibt es denn möglicherweise einen Weg, wie man zusammenkommen kann und wie man dann halt auch die Wählerinnen und Wähler mitnimmt, dann mussten wir die überzeugen.
Und das ist ja genau unser zweiter Auftrag.
Einerseits geht es darum, die Politen.
zu beraten, andererseits auch die Öffentlichkeit zu informieren.
Und deswegen sitze ich auch hier.
Ich weiß nicht, ob Herr Merz den Podcast regelmäßig hört, aber ich hoffe doch...
Ich hoffe sehr, dass er ihn hört, aber ich weiß es nicht genau.
Aber ich weiß, dass wir viel natürlich von Politikerinnen und Politikern gehört werden, die zum Teil ja auch bei uns zu Gast sind, die dann auch manchmal Kontakt mit uns aufnehmen, uns Dinge empfehlen, andere Gäste empfehlen.
Das könnt ihr im Übrigen auch tun, das passt an der Stelle.
ganz gut.
Ihr könnt schreiben bei Kontakt at will-media.de oder aber auch in den Kommentaren hier drunter bei Spotify, wenn er uns darüber hört, das geht alles und daraus machen wir in der Regel auch was.
Nicht, dass wir uns beeinflussen ließen, aber dass wir zum Beispiel Empfehlungen dann, wenn sie uns gut und richtig erscheinen, dass wir uns Die auch aufnehmen.
Ähnlich, glaube ich, arbeitet der Sachverständigenrat auf weitaus höherem Niveau.
Das ist mir auch klar.
Den gibt es seit deiner Zeit seit der Jahre.
die Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen, wie Sie es gesagt haben.
Und jeweils im Herbst dann übergibt er regelmäßig ein Jahresgutarten.
Das ist dieser Fototermin, den wir kennen.
Zudem die Bundesregierung dann öffentlich Stellung beziehen soll, machen die das eigentlich richtig?
Ja.
Und machen die das auch ihrem Verständnis nach ernsthaft?
Oder erinnere ich auch solche Momente, in denen das so abfällig, ja, ja, und irgendwie nicht so richtig, sagen wir, wertschätzend aufgenommen wurde?
Also es gibt zwei Arten, wie die reagieren, natürlich reagieren die an dem Tag selbst, wenn wir das übergeben.
Vor laufender Kamera, freundlich, aber knapp natürlich.
Dann reagieren die...
Dann kennen die das gut.
Ja, dann kennen die das gut.
Wir geben ihnen das einen Tag vorher, damit sie auch schon mal reagieren können.
Und sind nur drei Seiten, die man dann rasch durchlebt.
Da sind dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt.
Die müssen dann in einer Nachtschicht das schnell lesen und dann auch entsprechend exzappieren und sagen, da stehen folgende Sachen drin.
Also dann gibt es auch eine Presseerklärung, in der sie...
drauf reagieren.
Manchmal passiert das wirklich sehr unmittelbar, also es ist uns schon mal passiert, dass wir was aufgeschrieben haben und dann hat der damalige Finanzminister wirklich parallel zu unserer Pressekonferenz sich schon hingestellt und gesagt, das hält ja für Blödsinn.
Christian Lindner war das.
Das war genauso, ja.
Tatsächlich.
aber die offizielle Reaktion ist dann im Form des Jahreswirtschaftsberichts, also das Wirtschaftsministerium, veröffentlicht ein Jahreswirtschaftsbericht, der wird mit der gesamten Regierung abgestimmt.
Und da gibt es wirklich die grundgelb markierten Stellen, in denen sie auf unser Gutachten eingehen.
Und dann sagen sie, haben wir schon gemacht oder haben wir eigentlich vorzumachen oder ist aber Blödsinn.
Also das formulieren die alle sehr viel.
Umständlicher.
Ja, sehr viel.
Formaler.
Aber ja, genau, das machen die dann.
Und das heißt, an der Stelle kann man genau nachschauen, wie haben Sie sich denn damit beschäftigt und wie gehen Sie darauf ein?
Ist das freutvoll dann für Sie?
oder sagen Sie, man ey, die haben das gar nicht genau gelesen, die wollten das nicht wissen, das ist doch eine müde Reaktion.
oder sind Sie beeindruckt?
Ach, klasse, hätte ich gar nicht gedacht.
Also die lesen das schon sehr genau.
Also die, die das machen müssen, die im Ministerium sich damit beschäftigen müssen, die lesen das schon sehr genau.
Je nachdem mit was sie sich dann gerade beschäftigen, lesen sie das wirklich auch sehr interessiert, weil gerade in Zeiten, die schwierig sind, wo die Antworten nicht so offensichtlich sind, wollen die ja natürlich auch Anregungen haben.
Manchmal gefallen die Anregungen aber eben nicht.
Und dann wird auch entsprechend drauf reagiert.
Das Gremium der Sachverständigenrat hat fünf Mitglieder, drei davon.
Bei ihnen ist das auch der Fall, werden von der Bundesregierung benannt.
Das sind sie auch jeweils eins auf Vorschlag der Arbeitgeberverbände bzw.
das andere dann auch auf Vorschlag der Gewerkschaften.
So eine Amtszeit dauert fünf Jahre und kann einmal verlängert werden.
Sie sind jetzt seit zwanzig, zwanzig dabei, also fünf Jahre, sind seit zwanzig, zwanzig die Vorsitzende des Sachverständigenrates, damit die erste Frau an der Spitze des Sachverständigenrates.
und im wahren Leben, das würde ich auch dazu sagen, sind auch Sie-Professoren, nämlich an der LMU in München.
Wie verstehen Sie Ihre Rolle auch gegenüber der Öffentlichkeit?
Ja, tatsächlich eben als Aufklärerin.
Also ich glaube, eine ganz wichtige Funktion ist, dass wir den Menschen erklären, was wir da aufschreiben, wie die wirtschaftliche Lage ist, was die Handlungsoptionen sind und das in einer verständlichen Sprache.
Zwingen Sie sich zur Neutralität auch?
Ja, natürlich.
Das muss ich mich nicht dazu zwingen.
Ich bin neutral.
Bisher verstehe mich als solche.
Ich bin ja auch nicht Mitglied in irgendeiner Partei, ganz bewusst auch nicht, davon abgesehen, dass es mir schwerfällt, fallen würde, mich da jetzt nur mit einer Partei zu identifizieren.
Aber das ist wirklich wichtig, dass man neutral ist, dass man auch transparent darüber Rechenschaft abgibt, wenn das nicht der Fall wäre.
Wir wissen ja, wie gesagt, sie sagten eben selbst einer von Arbeitgebern vorgeschlagen, einer von der Gewerkschaft vorgeschlagen.
Also das sind Dinge, die schon transparent sein müssen.
Und ja, es hat natürlich was mit der Glaubwürdigkeit zu tun, dass das alles transparent ist.
Und man dann ...
auch wirklich als Expertin, als Wissenschaftlerin verstanden wird, die nicht eine politische Agenda verfolgt, sondern wirklich einfach aufklären will.
Zu Ihrer Rolle gehört, das haben Sie gerade auch schon gesagt, dass Sie Interviews geben oder aber freundlich Podcast-Einladungen annehmen.
Letzt haben Sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ein Interview gegeben am fünfundzwanzigsten August und da werden Sie gefragt, wie bewerten Sie die ersten einhundert Tage der Bundesregierung?
und Sie beginnen freundlich und sagen, die Regierung ist mit Volldampf gestartet, was man anerkennen muss.
Wir haben eine schwierige Weltlage und die Priorität lag erst einmal auf den außenpolitischen Themen.
Dann kommt...
Was Wirtschaftsthemen angeht, hat sie einiges in Aussicht gestellt und ist auch schon einiges angegangen.
Der große Wurf fehlt aber noch.
Und dann fragt die Kollegin Johanna Apel natürlich nach, wo drängt es besonders?
Und dann sagen sie, wir müssen uns auf jeden Fall mit den Sozialversicherungen beschäftigen.
Wenn die Regierung nichts tut, wird der Kollaps unweigerlich kommen.
Zitat Ende, Bums.
Da war Ihnen wahrscheinlich in dem Moment auch schon klar, das würde die Überschrift, die dieses Interviews werden.
Und es ist auch dann, wussten Sie da noch nicht, haben wir aber daraus gemacht, die Titelfrage dieser Folge unseres Podcasts geworden.
Wir nennen Sie also, wie ist der Kollaps des Sozialstaats noch zu verhindern?
Was bedeutet Kollaps in Ihrem Verständnis?
Naja, einfach um das einzuordnen, wir haben einen demografischen Wandel, so heißt das.
Das heißt, die Menschen werden immer älter.
Die Babyboomer, die besonders geburtenstarke Generation, die geht jetzt bald in Rente.
Dann sind nicht mehr so viele, die in Zukunft Beiträge zahlen, mit denen man die Renten finanzieren kann, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung.
Diese Babyboomer-Generation hat nicht so viele Kinder bekommen, als dass die Bevölkerung konstant bleiben würde.
Es gibt sehr viel Zuwanderung.
Ja, das bedeutet, wir werden in Zukunft immer weniger Junge haben, die für immer mehr Alte aufkommen müssen.
Und die alten Leben auch noch immer länger.
Und die alten Leben auch noch immer länger.
Also um das in paar Zahlen einfach mal zu verdeutlichen, momentan ist es so, eine Rentnerin kommt auf drei Menschen, die Jünger sind, die also noch in berufstätigen Alters sind.
Das ist in zehn, fünfzehn Jahren sind das ein Rentner, ein Rentner auf zwei junge Menschen.
Also dieses Verhältnis von alt zu jung, das wird sich in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern.
Und wir haben gerade gehört, die leben einfach länger.
Also heute sind die Menschen um die acht Jahre länger in Rente.
Die Rentenzeit hat sich um acht Jahre erhöht im Vergleich zu vor vierzig Jahren.
Also die Menschen leben einfach immer länger.
An meinem eigenen Beispiel kann ich das erläutern, meine Großeltern.
Tatsächlich hab ich die gar nicht erlebt.
Die sind alle verstorben, die waren keine fünfundsechzig.
Zum Teil früher, sehr viel früher, zum Teil halt um dieses Alter herum.
Meine eigenen Eltern sind inzwischen leider auch verstorben, aber die sind Anfang neunzig gewesen, als sie verstorben sind.
Also, das ist natürlich jetzt ein sehr anektotischer Fall.
Ich hab ja eben gerade gesagt, das sind eigentlich acht Jahre, die die Menschen inzwischen länger leben.
Aber das ist ein Riesenunterschied.
Und das heißt, die einen haben überhaupt keine Rente bekommen, die anderen haben doch immerhin, für zwanzig Jahre.
Und länger Rente bekommen, das muss irgendwie finanziert werden.
Nun weiß man das ja schon ewig und kann sich gerade eine demografische Entwicklung natürlich relativ gut erschließen, weil die Menschen dann Weile brauchen, bis sie auch tatsächlich in Rente gehen würden.
Warum hat man sich nicht besser darauf gefasst gemacht?
Tatsächlich hat man schon lange darüber geredet.
Altenfang der Zweitausenderjahre gab es ja auch schon mal eine Rentenreform.
Damals hat Münter Ferien gesagt, das kann man sich an den drei Fingern abzählen, braucht es nur Volksschule Sauerland.
Das reicht schon, um zu sagen, das wird nicht funktionieren.
Damals gab es auch eine Rentenreform.
Damals gab es diese Reform, die das Renteneintrittsalter über mehrere Jahre verteilt auf siebenundsechzig erhöht hat.
Das war also wirklich eine eine wichtige Reform.
Dann hat sich es nicht ganz so schlecht entwickelt und das kann man an zwei Sachen sehr gut festmachen.
Warum dann auf einmal sich die Situation nicht so schlecht entwickelt hat?
Das lag einerseits dran.
Damals war die Arbeitslosigkeit sehr hoch, da waren wir bei zwölf, dreizehn Prozent Arbeitslosigkeit.
Und das hat sich dann sehr stark reduziert.
Da sind wir bei sechs Prozent gerade ein bisschen am Ansteigen, aber immer noch sehr gut.
Das heißt, es waren auf einmal sehr viele mehr Menschen in Arbeit und deswegen sind die Beiträge auch die Beitragssaalungen höher gewesen.
Das war natürlich eine gute Entwicklung.
Das andere Anfang der zweitausender Jahre hatten wir.
eigentlich keine Zuwanderung, eigentlich im Grunde fast eine Auswanderung, also netto Auswanderung.
Und das hat sich deutlich erhöht.
Also auch dadurch haben wir jetzt mehr Beitragszahler erinnern als damals.
Und das hat bei der Politik dazu geführt, als wir unsere Rentengutachten vorgelegen hatten, der letzte Kanzler hat dann gesagt, der hat dann gesagt, na ja, die Experten haben schon immer gemahnt, es kam ja nicht so schlimm.
Und ja, tatsächlich in diesen zwanzig Jahren hat sich es besser entwickelt, als man dachte, das Schlimme ist nur, oder man muss sich drüber im Klang sein, das wird nicht noch mal so gehen, denn von sechs Prozent auf null Prozent werden wir die Arbeitslosigkeit nicht runtertreiben.
Und dass wir die Zuwanderung noch mal so viel erhöhen, ganz im Ernst, die Bevölkerung macht das wahrscheinlich nicht mit, denn die ist ja schon aktuell, der Meinung, sie ist überfordert von der Zuwanderung.
Insofern also, Ja, gute Gründe, warum sich in den zwanzig Jahren nicht so schlimm entwickelt hat, wie damals befürchtet, weil sich einige Sachen verändert haben, wirtschaftliche Entwicklung war besser, mehr Menschen sind zugewandert, aber momentan sieht es nicht danach aus, als ob man das nochmal wiederholen könnte.
Jetzt haben sie gesagt, ich zitiere es nochmal.
Wenn die Regierung jetzt nichts tut, wird der Kollaps unweigerlich kommen.
Wie groß ist ihr Vertrauen, dass diese Regierung da jetzt was macht?
Denn sie haben es gesagt, die Rentenreform, die Letzte, die wir hatten, liegt echt lange zurück.
Das war Franz Mündefering.
Und ich weiß gar nicht, wann der, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, ich glaube, im Jahr, Ja, also momentan, muss ich sagen, bin ich nicht so ganz zuversichtlich.
Die Reformkommission, die sich damit jetzt beschäftigen soll, die soll erst im nächsten Jahr überhaupt zusammengestellt werden, dann soll sieben und zwanzig da einen Vorschlag auf dem Tisch liegen.
Dann sind wir schon hart an dem nächsten Wahlkampf dran.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann sich über wirklich harte Reformen verständigen wird, dass es, würde ich sagen, geht gegen Null.
Denn es war ja jetzt schon im Wahlkampf so, dass die SPD ganz klar sagte, also keine Erhöhung des Renteneintrittsalters, keine wirklichen Einschnitte.
Im Gegenteil, also zementieren dessen, was wir gerade haben.
Die Rentnerinnen und Rentner sollen nicht drunter leiden.
Und dann haben wir erlebt, dass die CDU dann sagte, ja gut, dann wollen wir diese Rentendiskussion auch nicht aufgreifen, sonst werden wir in diesem Wahlkampf zerrieben über diese Frage.
Und dann hat man das völlig ausgeklammert.
Im Grunde haben man sich wechselseitig überboten, was man alles noch mal zusätzlich geboten hat und von ganz links und ganz rechts erst recht.
Das heißt, man hat es in diesem Wahlkampf ausgeklammert, man wird es im nächsten Wahlkampf dann vielleicht auch nicht angehen.
Ich bin zumindest nicht besonders zuversächlich.
Und das heißt, wir verschieben das immer weiter und wir sehen, was passiert.
Wir sehen, die Sozialversicherungsbeiträge werden immer weiter steigen müssen, denn irgendjemand wird es ja bezahlen müssen.
Das heißt, die Beitragszahlerinnen werden es bezahlen müssen.
Beziehungsweise die Steuerzahlerinnen.
Nur im Haushalt haben wir jetzt schon große Löcher.
Das wird nicht funktionieren.
Und deswegen dieser Begriff.
Ja, wir laufen einen Kollaps zu, wenn wir nicht doch noch am Ende die Kurve kriegen.
Wie ist der Kollaps des Sozialstaats noch zu verhindern?
Das würde ich gerne wissen.
Und Sozialstaat meint ja sogar noch mehr.
Als allein die Rente, da fokussiert man sich mal schnell drauf.
Das ist auch ein sehr gutes Beispiel für viele Menschen.
Sehr, sehr relevant, keine Frage.
Aber zum Sozialstaat und zu dem sozialen Sicherungssystem gehören natürlich noch ein paar mehr.
Die Pflegeversicherung, die zunehmend unter Druck gerät.
Die Krankenversicherung gehört dazu.
wird am meisten und beinahe ausschließlich diskutiert über das Bürgergeld, wo sich gar nicht mal so viel einsparen ließe.
Vor allem die Union im Wahlkampf, auch der jetzige Kanzler persönlich getan hat.
Wir haben auch jetzt alle den Streit mitbekommen, denn sehe ich Friedrich Merz und die Arbeits- und Sozialministerin und Co-Vorsitzende der SPD-Berbel-Bars geliefert haben.
Merz hatte bei der CDU in Niedersachsen, vielleicht macht man das da so gesagt, Zitat der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar.
Bas hatte dem dann entgegnet, das sei Bullshit.
Und die beiden haben sich dann zusammengehockt.
und zwei Bier und ein Koalitionsausschuss.
später klang der Kanzler interessanterweise ganz anders und sagt jetzt, das können wir uns anhören über den Sozialstaat und die Pläne der Bundesregierung folgendes.
Wir sind uns einig, dass wir den Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland erhalten wollen.
Wir wollen ihn nicht schleifen, wir wollen ihn nicht abschaffen, wir wollen ihn nicht kürzen, sondern wir wollen ihn auf seine wichtigsten Funktionen, in seinen wichtigsten Funktionen.
erhalten.
und das heißt, wir müssen ihn reformieren.
Ich weiß gar nicht, was hören Sie raus?
Ja, natürlich wissen die, dass sie irgendwie zusammenkommen müssen.
Das ist ja, glaube ich, eine der wichtigsten.
lehren aus der letzten Koalition, dass es ja gar nicht anders geht, als sich zusammenzuraufen.
Und da muss man sagen, war der Staat ja durchaus etwas holprig.
Also wir haben ja schon ein, zwei Situationen erlebt, wo es gerade nicht so gut lief, dass die sich zusammengerauft haben.
Genau, die Beschriebene zum Beispiel auch, dann die gescheiterte Richterwahl und und und.
Genau, also da muss man einfach sagen, jetzt wäre schon höchste Zeit, man solche ja unnötigen Streitarreiten zu vermeiden und sich da zusammenzuraufen.
Also so, wenn das ist ein gutes Zeichen.
Das ist ein gutes Zeichen, was er sagt, weil er sagt, wie gesagt, was hören Sie daraus?
Er sagt, wir sind uns irgendwie einig, dass wir den Sozialstaat erhalten wollen.
Dann sagt aber, wir wollen ihn nicht schleifen, wir wollen ihn nicht abschaffen.
Dann ringt er um Worte hörbar.
Wir wollen ihn nicht kürzen, was insbesondere bei den Wirtschaftsnahen in der Unionsfraktionen total schlecht angekommen ist.
Und jetzt sagt, was?
Wie?
Was?
Was?
Was?
Er will nicht kürzen.
Das wird auch nicht gehen, wenn er eben noch gesagt hat, der ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, gar nicht finanzierbar.
Und dann sagt er, wir wollen ihn in seinen wichtigsten Funktionen erhalten.
Was hören Sie daraus?
und kommen zurück drauf im Sachverständigenrat?
Was machen Sie daraus, was der Bundesregierung in gestaltes Kanzler, der Arbeitsministerin, denn jetzt empfehlen in Sachen Sozialstaat?
Also tatsächlich muss man reformieren, aber ich glaube, es ist an der Stelle auch mal ganz wichtig zu sagen, was das alles für verschiedene Teile des Sozialstaats sind und wo man jeweils reformieren muss und kann und was man damit auch sparen kann oder sparen will.
fangen wir mal an.
Diese Diskussion hat sich ja sehr stark an dem Bürgengeld entzündet, weil man sagte vor der Wahl, na also das also zumindest die CDU hat das ja gesagt CDU CSU.
Wir können es vieles an Steuererleichterungen zum Beispiel leisten, wenn wir nur das Bürgergeld entsprechend zusammen sind.
Zwei-stellige Milliardenbeträge sein zu holen, hat der Kanzler gesagt, Thorsten Frey hat dann gesagt, dreißig Milliarden.
In Spanien hat er gesagt, zehn Milliarden.
Zuletzt hat er gesagt, fünf Milliarden.
So ist man bei.
wer bietet eigentlich weniger.
Ja, genau.
Also, wenn man eine Milliarde einsparen kann, ist das, glaube ich, viel.
Das ist jetzt ein Teil des Sozialstaats, wo es wirklich darum geht, denen, die ja nicht in Arbeit sind, aus den unterschiedlichsten Gründen, Unterstützung zu geben.
Das ist verfassungsrechtlich auch notwendig.
Also man kann keinen verweigern, am Leben hier teilzuhaben.
Das heißt, dass jeder hat einen Anspruch darauf.
Er hat natürlich auch Pflichten, nämlich sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen.
wenn er das denn kann gesundheitlich oder nicht, also jetzt in Pflege oder Kinderbetreuung oder so eingebunden ist, dass er das nicht machen kann.
Und an der Stelle geht es also wirklich um die Solidarität der Büffelgerung und gleichzeitig aber natürlich auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen.
Da kann man nur begrenzt kürzen.
Weil, wie gesagt, man muss lebenswürdige Lebensverhältnisse haben.
Das heißt, das kann man nicht auf null runterkürzen.
Genau, das Verfassungsgesagt, das sogenannte Extensminimum muss gesichert sein.
Man darf nicht auf null reduzieren.
In Ausnahmefällen für zwei Monate geht es vielleicht, aber das müssen strenge Voraussetzungen sein.
und und und und und.
Also da ist das Verfassungsgericht vor.
Genau.
bedeutet aber auch, wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen sind da möglicherweise von Betroffenen, weil sie sich dem Arbeitsmarkt verweigern, weil sie ihre Termine nicht einhalten.
Das sind vielleicht vielleicht fünfzehn, sechzehn draußen Menschen.
Wenn man denen jetzt mal eine gewisse Zeit ein bisschen was kürzt, dann ist das ein überschaubarer Betrag, der da zu kürzen ist.
Das heißt nicht, dass man das nicht tun sollte und an der Stelle will ich einfach mal unterscheiden.
Will man reformieren, einfach um Geld zu sparen?
Viel Geld kann man oft die Weise nicht sparen.
Was man aber machen kann, ist das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen zu stärken.
Wenn die sagen, da verweigern sich manche, das ist doch nicht okay, dass ich die dann finanziehe, dann haben sie recht.
Natürlich muss man die Menschen dazu bringen, sich dem Arbeitsmarkt wirklich zur Verfügung zu stellen.
Und allein deswegen sollte man hier natürlich auch reformieren und sie stärker sanktionieren bzw.
sagen, ja, so geht es nicht.
Wir müssen schon dafür sorgen, dass er euch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt.
Wirklich Geld sparen wird man dann, wenn die Arbeitsmöglichkeiten haben.
Also wenn die Konjunktur anspringt, wenn man die wirklichen Arbeit bringt, dann wird man eine ganze Menge mehr Geld sparen.
Von dem sanktionieren selber wird man nicht so viel haben.
Aber nochmal an der Stelle.
Gerechtigkeit zu empfinden.
Das ist also politisch ein kluger Schachzug.
Aber Geld sparen wird allein dieses Sanktionär nicht.
Der Sozialstadt ist noch sehr viel mehr als allein das Bürgergeld, aber komischerweise ist diese Diskussion im Moment am hitzigsten geführt worden.
Darüber habe ich gestern mit dem Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte auch ein Interview gemacht und habe ihn da, das war unsere Titelfrage, vor allem gefragt, wohin führt dieser Streit um das Bürgergeld eigentlich?
Und Bovenschulte sagte, SPD man.
Er unterstellt, dass man damit ein Klima schaffen will, indem man dann radikalere Einschnitte bei den anderen Sozialversicherungssystemen eher politisch durchgesetzt bekäme.
Kann das sein?
Ob das hilft, das weiß ich nicht, weil wir reden ja schon über sehr unterschiedliche Gruppen.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns überlegen können wir im Rentensystem Reformen durchsetzen, dann reden wir hier über sehr unterschiedliche Gruppen.
Wer sagt beim Bürgergeldbus eingespart werden, der redet darüber, das sind welche, die gehen nicht zur Arbeit, die wollen sich drücken oder die gehen schwarz arbeiten oder so.
Da ist, glaube ich, offensichtlich, dass man sagt, da muss doch gekürzt werden.
Bei den Rentnern und Rentnern sagt jeder sofort, oh, die haben doch eingezahlt, die haben lange gearbeitet, denen kann man doch nicht irgendwas zumuten.
Ich glaube, die zwei Gruppen wird man da nicht gegeneinander ausspielen, dass das, glaube ich, wird nicht funktionieren.
für die Reformen im Rentensystem tatsächlich wirklich ganz anders argumentieren, nämlich genauso wie ich es eben auch sagte, dass das Geld nicht mehr lange reichen wird und dass wir das in der Tat ganz neu aufsetzen müssen.
Nun hat ja der Kanzer gesagt, wenn wir uns das anschauen, wie wir gesamtwirtschaftlich oder volkswirtschaftlich, so sagt er, aufgestellt sind, was wir uns überhaupt noch leisten können, dann ist der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, nicht mehr finanzierbar.
Stimmt das denn eigentlich?
Also er ist insofern nicht mehr finanzierbar, weil dieser Teil des Sozialstaats, das ist der Teil quasi als Sozialversicherung organisiert, das ist die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung.
Der ist ja über Beiträge eigentlich finanziert.
Das ist die Grundidee.
Das heißt, die Menschen, die arbeiten, die zahlen Beiträge in die Rente beispielsweise.
Und aus diesen Beitragseinnahmen werden dann die Aussahlung finanziert.
Und wenn wir, ich habe es ja am Anfang erläutert, immer weniger junge Leute haben, die arbeiten, dann reichen irgendwann die Beiträge nicht mehr.
Dann kann man nur entweder die Beiträge erhöhen oder aber die Aussahlungen.
nicht mehr so stark steigen.
Wir reden gar nicht drüber, das ist auch gar nicht unser Vorschlag, die zu kürzen, aber die Anstiege zu begrenzen.
Denn man muss auch verstehen, die Renten steigen normalerweise jedes Jahr mit dem Lohnsteigerungsniveau.
Also das heißt, wenn die Löhne ansteigen, wenn sie in den letzten Jahr wollen, ja auch der Inflation gestiegen war, dann steigen auch die Renten mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung.
Und das bedeutet, Das könnte man etwas begrenzen.
Man könnte es insbesondere auf das Inflationniveau begrenzen.
Also das ist, was in Österreich beispielsweise passiert.
Das heißt, die Renten steigen mit der Inflation, sodass man nicht realärmer wird, aber halt auch nicht realreicher, wie wir es momentan eigentlich normalerweise haben, wo die Löhne eben stärker steigen als die Inflation und das heißt, die Menschen alle ein bisschen reicher werden.
Aus den Beiträgen werden die Auszahlungen finanziert bei den Versicherungssystemen, aber das reicht ja auch jetzt schon nicht.
Da kommt ja ein satter Zuschuss aus dem Aufkommen der Steuerzahlergemeinschaft dazu.
Ja, das erklärt sich so.
Es gibt eben Leistungen, die in Form von Rente ausgezahlt werden, für die aber nie Beiträge gezahlt worden sind.
Das ist, beispielsweise, die Mütterrente.
Also Mütterrente bedeutet, die Frauen, die vor deiner Zweiundundzeig Kinder bekommen haben.
die bekommen für die Kinder, bis ihr jetzt beinhalb Rentenpunkte angerechnet, jetzt sollen es drei werden.
Das ist ja gerade beschlossen worden.
Findet es nicht gut, ne?
Nein, das bin ich nicht gut.
Vielleicht warum.
Ja, die haben ja dafür keine Beiträge gezahlt.
Und deswegen sagt man auch, na ja, dann ist es nicht okay, dass das aus den Beitragszahlungen finanziert wird.
Das wird aus den Steuern finanziert.
Und das Gleiche gilt für die Wittwin-Rente.
wieder so.
Bei der Witwen-Rente ist es so, dass es für, typischerweise, eine Frau, wenn die ihren Mann überlebt und selber nicht genügend Renteneinkünfte hat, dann bekommt die eben ein Teil, dass der Rente, die sonst der Mann bekommen hätte, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt, jetzt jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt.
Das ist wiederum etwas, dafür sind keine Beiträge gezahlt worden.
Also wenn ihr überleben würde, würde ihr ja seine volle Rente weiter kriegen.
Stimmt.
Und wenn sie überlebt, dann kriegt sie eben gut die Hälfte dieser Rente.
Dafür ist nie was gezahlt worden und deswegen wird das auch aus der...
aus dem Haushalt, aus dem Steuergeld bezahlt.
Man nennt es sozusagen Beitragsfremdeleistungen, also sind nicht für Beiträge entrichtet worden.
Und das ist es genau, was aus dem Haushalt bezahlt wird.
Und das ist ein Viertel des Haushalts, das muss man sich mal klarmachen.
Das allein sind hundertzwanzig Milliarden ungefähr.
Ja, das ist viel.
Und das dachte ich, ist gemeint, wenn zum Beispiel der Kanzler sagt, das ist nicht mehr finanzierbar.
Denn im Moment, wenn wir uns die Lage anschauen, es wirkte zwar so mit den gigantischen Schuldenpaketen, dass Geld ohne Ende da wäre, aber in Wahrheit hat dann der Finanzminister mal scharf gerechtet und gesehen, was sie hier ...
Wahrscheinlich genauso gewusst hätten.
Im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im Haushalt, im vorne und hinten nicht mehr erhinkommen.
Viele ältere Menschen, die schon gepflegt werden, müssen hohe Zuzahlungen aufbringen.
Wenn sie das selber nicht können, müssen die Kinder ran und so.
Da ist Druck drauf, das weiß man auch.
Jetzt habe ich gestern besagtes Interview mit dem Bremer Bürgermeister gemacht und da komme ich an einer Stelle auf genau das, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe, was mir Konsens zu sein schien, dass ich sage, die sozialen Sicherungssysteme sind angesichts der demografischen Entwicklungen unterfinanziert und sind nicht zukunftsfest.
Und da fährt er mir in die Parade und sagt, nein.
Die Einschätzung teilt überhaupt nicht, denn es sei ja so, gemessen an der Wirtschaftskraft, werde aktuell nicht mehr Geld für den Sozialstaat ausgegeben als vor zwanzig Jahren und deshalb werde er jedenfalls den Sozialstaat mit Klauen und mit Zähnen verteidigen.
So, nochmal gefragt, ist der Sozialstaat doch weiter finanzierbar und steht gar nicht vor?
dem Kollaps, den Sie da auf uns zu donnen sehen.
Ich glaube, das große Problem ist, dass er die Momentaufnahme macht.
Und aktuell sind die Babyboomer ja noch am Arbeiten.
Das kommt ja jetzt gerade erst.
Also wir erleben eben, wenn man nochmal dieses Zahlenverhältnis anschaut von zwei jungen Leuten auf einen, älteren, also von drei auf zwei, das geht jetzt rasant nach oben.
Das ist wie so ein...
Anstieg, wie so ein Berganstieg.
In den letzten Jahren ging es so langsam vor sich hin.
Und jetzt geht es auf einmal nach oben.
Das heißt, wir werden das, diese wirklich schwierige Situation erst in den nächsten zehn Jahren erleben, aber dann massiv.
Und deswegen kann man sich jetzt nicht zurücklehnen.
Das ist wie wenn man aus dem Hochhaus springt und bis zum dritten Stock sagt, bis er erst noch alles gut gegangen hat.
Dann kommt die Erde auf einmal ganz schnell auf einen zu.
Wofenschulte macht eine Momentaufnahme und verschließt die Augen davor, was jetzt bald kommt.
Ja, ganz genau.
Und wir erleben das.
Sie haben gerade die Pflege angesprochen.
Wir erleben es eben da.
Wir haben die Leistungen deutlich ausgeweitet.
Richtigerweise.
Pflegekräfte sind besser bezahlt worden, z.B.
das war ganz sicherlich ganz wichtig.
Ja, ganz genau.
Also insofern ist das auch teurer, natürlich.
Also das System kostet jetzt mehr und das ist wirklich wichtig.
Aber wir haben jetzt auch Pflegeleistungen in einem Bereich, wo man sich fragt, dass das kann man vielleicht auch...
selber finanzieren.
Viele Menschen können das selbst finanzieren.
Nicht die Amsten, aber wir machen ja...
die Auszahlung aus der Pflegeversicherung nicht abhängig davon, wie viel Geld die Leute verdienen.
Also wenn die ersten Leistungen bezahlt werden, das heißt die Zuzahlung zur Inkontinenz, Windeln oder all solche Dinge, dann ist das etwas, wo man jetzt Zuzahlungen bekommt und das hätte man halt früher selber bezahlt.
Es sei denn, man kann sich es wirklich gar nicht mehr leisten.
Das heißt an der Stelle wird jetzt viel Geld ins System reingegeben und ja, das muss irgendwie finanziert werden.
Ja, dazu haben Sie in dem Interview, das ich schon angesprochen habe, mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auch was gesagt, wo ich mir sicher war, dass Sie dafür verdammt viel böse Post bekommen haben und bös beschimpft worden sind.
Sie werden da gefragt, wo Sie in Strich ziehen würden, bei dem, was jeder Einzelne, jede Einzelne dazu zahlen muss.
oder die Familien derjenigen, die alte Menschen in Pflege haben und die zum Beispiel sagen, ich will nicht die billigsten in Kontinenz windeln.
sondern ich will die nehmen, die nochmal besser funktionieren.
Und dann ist man boing mit den eigenen Zahlungen natürlich am Start.
Und dann sagen sie, solange die Menschen auch Vermögen besitzen, auch wenn es ein Eigenheim ist, dann muss das eben herangezogen werden.
Man kann nicht erwarten, dass der Staat das Eigenheim schützt, wovon am Ende die Erben profitieren, aber die Kosten der Pflege von der Allgemeinheit getragen werden.
Zitat Ende.
So, ich glaube, wann immer das Wort Und man könne da dran gehen, man müsse das verkaufen, um anderes damit zu finanzieren, dann sind die Leute auf Hundert Achtzig, oder?
Ja, in der Tat ist das genau so.
Natürlich bin ich da ganz massiv angegangen worden von den Leuten.
Es ist ja durchaus so, dass auch jetzt schon das belastet wird, aber das wird immer genau überprüft.
Also solange man selber drin lebt, sowieso noch nicht.
Und angenommen, man selber muss jetzt ins Pflegeheim, der Ehepartner, lebt aber noch in diesem Haus, wird das auch noch nicht belastet.
an der Stelle kann man sich schon überlegen, wie lange schützt man das, beziehungsweise sagt man nicht, ja, dann müsste das beleihen und dann lebt ihr quasi halt zur Hälfte bei der Bank, von der kommt jetzt der Kredit, sodass das bezahlt werden kann.
Auch wenn man das Heim vor, also das Haus schon vor mehr als zehn Jahren verschenkt hat, den Kindern, ist das außen vor.
Man muss also quasi nur rechtzeitig sich überlegen, wann will ich das dann übertragen an die Kinder?
und dann muss man sich mit denen auch verstehen, dass man da noch ...
weiter wohnen kann, aber da gibt es durchaus Möglichkeiten, sich dem zu entziehen.
Und da fragt man sich schon, ist das denn richtig?
Ich denke, nein.
Das heißt, ich denke, man sollte in erster Linie schon mal das auch selber finanzieren, solange man das eben kann.
Also es kann jedenfalls nicht sein, dass man es schon damit dann später die Kinder das Erben, das kann es nicht sein.
Also...
Tatsächlich, wenn jemand das jetzt vererbt hat an seine Kinder, hat sich das sogenannte Niesbrauchrecht zu sichern lassen, sagt, also bis zum Tode kann ich daran wohnen oder so lange ich jedenfalls will, dann würden sie daran gehen und würden sagen, bitte, das muss aber zur Finanzierung dann doch herangezogen werden.
Und es kann nicht sein, dass die Allgemeinheit finanziert, was den Erben dieses Familien, dieses Ehepaars, dieses Menschen zugutekommen würde.
Also an der Stelle muss man sich einfach überlegen, inwiefern die Kinder eben herangezogen werden, wenn die Kinder im Grunde über die Eltern ja an Vermögen gekommen sind, inwiefern man nicht die auch heranzieht.
Denn momentan werden die Kinder ja auch nur herangezogen, wenn sie mehr als hunderttausend Euro brutto verdienen.
Da schont man schon auch sehr.
und ja, die Frage ist, wie lange wir uns das noch leisten können.
Und was für Alternative es auch gibt, also ein Vorschlag, den man sich jetzt sehr genau anschauen müsste, den hat der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums gemacht, der sagte, da wir ja sehenden Auges auf die Situation zulaufen, jetzt die Babyboomer beispielsweise, die jetzt dann bald in Rente gehen, die werden ja auch alle mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zum Pflegefall.
Da könnte man jetzt noch etwas tun, um eben alles so was zu vermeiden, dass man sich am Ende anschaut, wer soll das denn finanzieren?
und kann das nur durch die Steuerzahlerin gemacht werden.
Der Vorschlag von denen war, im Grunde sollte jeder jetzt schon ...
verpflichtet werden, für die Pflege anzusparen.
Und das Geld sollte dann auch wirklich für die verwendet werden, die das angespart haben.
Also wenn jetzt die Baby-Boomer-Generation Jahrgang-Sächsig anspart, dann sollte das, was die in diesen Fonds einzahlen, später auch genau für ihre Pflege verwendet werden.
Und die von Jahrgang-Sächsich auch, und zwar in Sächsich etc.
etc.
Das heißt, die hitten ja im Schnitt, sagen wir mal.
noch zwanzig Jahre Zeit, wer jetzt mit fünf und sechzig vielleicht in Rente geht, der hätte noch zwanzig Jahre bis er mit Mitte achtzig vielleicht an Pflegefall wird.
Und das sollte auch genutzt werden, weil mit bestimmter Wahrscheinlichkeit man zum Pflegefall wird, dann sollte man das, was man vorher hatte, auch da schon entsprechend angespart haben.
Jetzt haben wir schon angesprochen, Sie kriegen böse Post, sobald das Wort fällt, geht doch an einen Eigenheim, da musst du das eben verselbern, dann kann man daran von die Pflege bezahlen.
Jetzt sagen Sie, man sollte vorsorgen am Kapitalmarkt.
Das sind alles so die roten Lämmchen, die bei ganz vielen Menschen angehen, gerade in Deutschland, die sich entweder, wenn sie sehr jung sind, gar keinen Bock haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil sie das überhaupt nicht auf sich zukommen sehen, weil sie vielleicht auch natürlich nicht das Geld haben, um mir zu sagen, komm, dann baue ich mir nebenher noch eine tolle Vorsorge sowohl für ausbleibende Rentenzahlungen als auch für vielleicht nicht hinreichende Pflegekosten auf.
Das kann man sich ja alles leicht vorstellen, dass man das nicht macht und dass man wenn man sich anschaut, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich an Altersversorgung?
Viele haben nicht genug jedenfalls, die sind nicht arm, aber viele haben dann vielleicht nicht so viel, dass sie noch ...
zusätzlich noch ein Aktienform bespielen wollten, oder?
Die Frage ist ja, wie viel man zur Verfügung hat.
Und wenn das ein gewisser Prozentsatz ist, dann werden die Leute unterschiedlich viel derein geben.
Aber das funktioniert ja genau auch jetzt so, dass man diese Pflegebeiträge, dass die auch am Einkommen orientiert sind.
Also insofern, man könnte das schon geschickt machen, so dass Wer mehr leisten kann, dann auch da mehr einzahlt.
Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, wenn wir so was jetzt nicht machen, also wenn wir nicht diese Art von Reform haben, dann bleibt das alles an den jungen Menschen hängen und an denen hängt ohnehin schon ganz viel.
Und deswegen ist das bei der Pflege so...
bietet sich das so an.
Also wer jetzt schon in Rente ist, der kann nicht mehr für seine eigene Rente aufkommen.
Also der kann jetzt nicht sagen, das spare ich da noch viel für meine eigene Rente, aber für die Pflege eben schon, weil da die Kosten erst in zwanzig Jahren auftreten.
Von dem, was jetzt beschlossen worden ist, das ist zum Beispiel nicht dabei, was die Berater des Wirtschaftsministeriums davor schlagen.
Was bislang beschlossen worden ist von dieser Bundesregierung, muss man sagen, hilft jetzt eigentlich den Systemen wenig bis gar nicht belastet sogar.
Wenn wir hinschauen, was beschlossen worden ist, nämlich die Ausweitung der Mütterrente.
Wir haben es eben schon angesprochen und die sogenannte Aktivrente.
Das heißt Rentner, die freiwillig weiterarbeiten, die können bis zu zweitausend Euro Steuerverein zu ihrer Rente hinzuführen.
dann hilft das dem System ja auch nicht.
Also ja, das hilft jetzt dem jeweiligen Rentner, aber es stützt das System nicht.
Und die Mütterrente, die Ausweitung derselben auf drei Prozent, kostet das System.
Also fünf Milliarden, sagt man pro Jahr.
Genau.
Also warum passiert das?
Das ist, ja, das, warum kann ich sagen, das natürlich auch als Wellestimmen bringt.
Also bei der Mütterente scheint es offensichtlich wirklich so gewesen zu sein, dass man sich dachte, dass das gibt nochmal den entsprechenden Aufschwung bei den Wählerstimmen.
Sonst hätte man das wahrscheinlich nicht so mit Macht vorangetrieben.
Aber es kostet fünf Milliarden in der Tat und das in einer Phase, wo wir eigentlich...
gerade für ganz viele andere Themen das Geld bräuchten und uns massiver schulden, um jetzt die Verteidigung zu finanzieren, um die Infrastruktur endlich zu sanieren.
Und das heißt, es fehlt an allen Ecken und Enden.
Und wenn siebenundzwanzig das Geld fehlt, sie sagten schon, da wird dann...
Dreizig Milliarden?
Ja, dann auch, weil man dann schon wieder anfangen muss, langsam Schulden zurückzuzahlen, die man in der Pandemie aufgenommen hat.
Ja, also da gibt man Geld für was aus, was jetzt...
Der einzelnen Mutter übrigens gar nicht so viel bringt.
Das sind dann zwanzig Euro vielleicht im Monat.
Da schenkt sie am Enkel nochmal irgendwie drei Tafeln Schokolade oder so.
Und denen, die es wirklich brauchen, also die wirklich bedürftig sind, den nutzt es gar nicht.
Da muss man sich ganz drüber im Klaren sein.
Wer nicht genug Rente hat und deswegen in Grundsicherung ist, dem wird es eins zu eins abgezogen.
Denn in dem Moment, wo er mehr Rente hat, ist er weniger bedürftig.
Das heißt, das wird eins zu eins abgezogen.
Den Ärmsten hilft es also gar nicht.
Es hilft nur den, die schon jetzt ein gutes Ausgang haben.
Also, es ist wirklich unverständlich, dass man meint, dieses Geschenk machen zu müssen.
Bei dem anderen Thema Aktivrente vielleicht noch mal zur Erleutung, da ist ja die Idee, man möchte die älteren Menschen um motivieren, freiwillig länger zu arbeiten.
Jetzt reden wir überhaupt nur darüber, weil wir aktuell das System haben, dass man nach forty-fünf Jahren Abschlagsfreien Rente gehen kann, schon mit dreiundsechzig, bzw.
ganz korrekt ist es immer zwei Jahre.
vor dem aktuellen Renteneintrittsalter, das ist dann also aktuell um den Sechzig.
Und wenn wir mal bei der sieben Sechzig sind, dann ist es fünf und Sechzig.
Also das ganze Ding heißt nur noch Rente mit drei und Sechzig, weil es so mal eingeführt worden ist.
Aber es sind nicht mehr die drei und Sechzig.
Das passt sich jetzt allmählich an, genau.
Die sind Anspruch nehmen dürfen, die müssen diese Fünfundvierzig Beitragsjahre.
auf angespart, also gearbeitet haben.
Genau.
Das heißt, wir haben erstens mal die vorzeitigen Rente gehen lassen oder lassen sie vorzeitigen Rente gehen.
Das wird übrigens auch bezahlt von diesem Haushaltszuschuss.
Diese diese hundert und zwanzig Milliarden.
Da geht ein Teil rein, um das zu finanzieren.
Und die gehen ja vorzeitigen Rente haben dafür nicht noch mal extra was bezahlt.
Dann sagt man, okay, es fehlen uns aber die Fachkräfte.
Und statt, dass man jetzt sagt, okay, dann sagen wir doch mal.
Das schaffen wir wieder ab.
Die sollen halt auch so lange arbeiten, wie aktuell das Renteneintritt zahlter ist, also mit sechsundsechzig, siebenundsechzig.
Sagt man, nein, nein.
Jetzt sagen wir, wenn ihr jetzt freiwillig länger arbeitet, dann geben wir euch die ersten zweitausend Euro steuerfrei.
Wer macht das jetzt?
Wer nimmt das in Anspruch?
Der, der sowieso Lust hat, noch ein bisschen länger zu arbeiten.
Das sind ganz viele Selbstständige, die auch irgendwo eingezahlt haben.
Aber das sind vielleicht Antwälte, das sind Leute, die ...
sowieso länger arbeiten würden, die aber jetzt mit Handkurs diese zweitausend Euro steuerfrei dazu verdienen.
Also es gab Oder es gibt schon Berechnungen dazu.
Wie viel zusätzliche Arbeit wird das bringen?
Das ist herzlich wenig.
Wie viel zusätzliche Kosten wird das bringen?
Eine ganze Menge.
Da gibt es sehr viele Mitnahmeeffekte.
Also man zahlt zweimal.
Man schickt die Leute früh in Rente oder lässt sie früh in Rente gehen.
Und dann zahlt man ihnen noch was obendrauf, wenn sie doch arbeiten.
Aber das werden nur die in Anspruch nehmen, die ohnehin länger gearbeitet werden.
Also in jeder Beziehung doppelt bezahlt.
So, jetzt stelle ich mir noch mal die Sachverständigen vor, die Wirtschaftsweisen.
Verlieren Sie da nicht dann gelegentlich die Fassung?
Und dann Leute wirklich?
Nein, nichts von dem hatten wir aufgeschrieben.
Nichts von dem hätten wir empfohlen, weil das vorn und hinten nicht passt.
Die Rente mit dreiundsechzig, die unter Andrea Nahles eingeführt worden ist, das sagt ja Franz Müntefering, derjenige.
Wir hatten ihn eben schon mal SPD-Vorsitzender, SPD-Urgestein.
der die Rente mit Sechzig eingeführt hat.
Das war ja der gleichsam, der genau anders gedrehte Entwurf.
Der sagt auch, ein Fehler.
Ja.
Ein echter Fehler gewesen, hat auch ausweislich die Wahlergebnisse jetzt, der Umfragen, ja auch jetzt der SPD nix mehr gebracht.
Also ich weiß nicht, wie oft verlieren Sie die Fassung?
Ja, an der Stelle könnte man schon die Fassung verlieren.
Zumal jetzt bei dieser Rente mit Sechzig, nur um das nochmal klarzustellen.
Da wird ja immer behauptet, naja, das sind ja die Dachdecker, die können eh nicht mehr so lange aufs Dach steigen.
Die arbeiten gar nicht so lange, die schaffen das gar nicht.
Wer diese Rente in Anspruch nimmt, das ist ganz typischerweise jemand, der überdurchschnittlich gesund ist, der mindestens durchschnittlich verdient.
Und der sei ihm gegönnt, sich noch ein schönes Leben macht und Marathon läuft oder auf Kreuzfahrt geht oder sonst was.
Also das heißt, das sind in aller Regel eben genau nicht die, an die man so denkt, wenn man sagt, na ja, wir können dann überhaupt so lange arbeiten, wenn er schon fünf, vierzig Jahre gearbeitet hat.
Das sind Leute, die Fachkräfte waren möglicherweise jetzt einfach nur noch am Schreibtisch sitzen, also nicht nur noch, sondern halt am Schreibtisch sitzen, aber irgendwas nicht körperlich so belastet sind.
Also insofern ...
hat man ein wirklich falsches Verständnis, wenn man sich überlegt, warum macht man das?
Ja, ist man fassungslos.
Ich bin insofern fassungslos, das muss ich jetzt schon sagen, als die Schuldenremsenreform kam, gleich zu Beginn noch vor, vor Start der Regierung.
Ich das sehr unterstützt habe und gesagt habe, ja genau, brauchen wir jetzt.
Wir brauchen Geld für die Verteidigung.
Wir brauchen Geld, um die Infrastruktur endlich auf Vordermann zu bringen.
Wir müssen die Bahn ganz unbedingt sanieren.
Wir müssen dafür sorgen, dass die Brücken nicht mehr einstürzen.
Alles richtig, alles richtig, dafür brauchen wir Geld.
Wir haben dann gleich in unserem Frühjahrsgutachten geschrieben, dieses Geld muss aber jetzt für Investitionen ausgegeben werden.
Dann wird für zusätzliche Investitionen, genau, was die Grünen ja noch reinverhandelt haben.
bevor es dann beschlossen worden ist.
Dann können wir auch davon ausgehen, dass das einen Wachstumseffekt hat und dass sich das irgendwann auch mal selber finanziert, also dass da wirklich ein Wachstumsschub rauskommt.
Es darf nicht dafür ausgegeben werden, haben wir damals reingeschrieben, einfach nur für Konsum.
Die Tinte ist noch nicht trocken in dem Gutachten und schon dreht sich die Regierung um und beschließt all das, was wirklich einfach nur als Konsum zu bezeichnen ist.
Eine Mütterente.
Da wäre nie und immer Geld da gewesen, wenn man nicht diese Schuldenbremse reformiert hätte, um jetzt die Chance öffnen, da einfach mal Geld ein bisschen zu verschieben.
An der Stelle bin ich wirklich fassungslos.
Weil gerade von manchen, die gesagt haben, jetzt müssen wir mal unbedingt sparen beim Bürgergeld und so, dann dreht man sich um, gibt dafür Geld aus.
Dann kommen wir bei der Mehrwertsteuersenkung, bei der Gastro raus, wir kommen bei der Wiedererhöhung der Agrardiesel-Subvention an, bei der Pendlerpauschale, die erhöhtet.
Also viele Dinge, von denen man sagen muss, das ist wirklich Konsum.
It's nice to have, ja klar, jeder nimmt das gerne mit, aber das wird unsere Wirtschaft nicht in Schwung bringen.
Das ist ja eigentlich genau das, was wir momentan brauchen.
Wir müssen unsere Wirtschaft in Schwung bringen, damit dann auch die Menschen gar kein Bürgergeld mehr brauchen, sondern halt wirklich wieder einen Arbeitsplatz finden, dass alles wäre das, was jetzt passieren muss.
Und an der Stelle muss ich sagen, fehlt mir das Verständnis, dass man solche Maßnahmen beschließt und am Ende das Aufpumpt macht.
Das ist nicht in Ordnung.
Was machen Sie dann?
Sie könnten ja als Vorsitzende des Sachverständigenrates sofort zum Hörer greifen, sagen würde ich ganz gerne den Bundeskanzler mal sprechen.
Na ja, also wir sprechen.
Wir sprechen, wir sind ja auch diese Woche beispielsweise unterwegs.
Wir waren gestern im Arbeitsministerium.
Wir waren heute im Kanzleramt.
Wir sind morgen im Wirtschaftsministerium, im Finanzministerium.
Wir waren also ganz offizielle Anhörungen.
Das ist auch Teil unseres Programms.
Und natürlich sagen wir das.
Wir sagen es, ja, ich sag's jetzt hier im Podcast, ich sag das in Interviews, dass wir eben da überhaupt kein Blatt für den Mund, natürlich sagen wir das.
Und die Verantwortlichen wissen das auch, dass wir das nicht in Ordnung finden.
Egal, nach mir die Sinnflut oder was ist die Haltung, die Sie da spüren?
Ja, das hängt, wie gesagt, sehr davon ab, mit wem man da ein spricht.
Der eine wird dann sagen, na ja, ich selber hätte es jetzt auch nicht gemacht, aber dann ist das wieder der Koalitionspartner.
Ja, dann muss man sich halt mal schon mal fragen, an welcher Stelle man den Konflikt endlich mal aushält.
Darüber habe ich gestern auch mit Herrn Bovenschult gesprochen und ich muss sagen, ich war dann doch echt überrascht auch ernüchtert, wie sehr Andreas Bovenschulte Sozialdemokrat überzeugt davon, dass man auch zum Beispiel vermögende große Erben anders besteuern sollte.
Der hat im Ohr, dass sein Vorsitzender ja ganz zart gesagt hat, es solle keine Denkverbote in der Frage geben, ob man über Steuererhöhungen und auch Belastungen für dann vermögende Menschen auch mal ein bisschen mehr Geld reinkriegt wieder in den Bundeshaushalt.
Ja, ich habe ihn gefragt und hatte das Gefühl, er ist jedenfalls jetzt nicht wild entschlossen, da große Reformen noch anzugehen in dieser Bundesregierung.
Bremer Bürgermeister sitzt nicht selbst in der Bundesregierung, aber natürlich Kontakte zur SPD ist ja logisch.
Und wir sind ja am Anfang dieser Regierungszeit.
und eigentlich sagt man, wenn überhaupt, dann muss man sowas am Anfang machen.
Nicht, dass man, wie Sie es beschrieben haben, in den dann nächsten Wahlkampf gerät und kann es dann schon gleich lassen, weil man sich das nicht mehr leistet.
Mal hören wir mal, was er gesagt hat.
dazu, als ich ihm sagte, warum geht die Sozialdemokratie, die dieses schlechteste Wahlergebnis ever auf der Uhr hat?
die jetzt in den Umfragen ganz schlecht dasteht.
Warum geht die nicht hin und präsentiert jetzt ein sauber durchgerechnet, super, klasse, gearbeitetes Sozialstaats- und Steuerkonzept gegen die, das sich vernünftigerweise gar nichts einwenden ließ, hätte eine andere Diskussion als die immer ewig gleiche über das Bürgergeld, hätte diese Diskussion darüber, ob das nicht ein kluger Vorschlag wäre.
und dann hat er das hier gesagt.
Was nützt einem ein Konzept und was nützt einem Forderungen, von dem man weiß, dass sie ganz schwer bis gar nicht durchzusetzen sind?
Nehmen wir mal die Vermögensteuer.
Vermögensteuer wird es mit dieser Regierung nicht geben.
Das ist so klar wie Klosbrühe.
Man kann vielleicht eine Absenkung der Erbschaftsteuer oder was vielleicht ganz sicher eine Absenkung der Erbschaftsteuer verhindern, aber eine Wiedereinführung der Vermögensteuer wird es nicht geben.
Man konnte verhindern, dass der Soli insgesamt gestrichen wird.
Aber dass man jetzt den Soli ausweitet, das wird es natürlich nicht geben.
Und mit der Digitalsteuer hat Herr Weimar von der CDU gefordert, trotzdem hätte ich so jetzt meine Zweifel, ob man da jetzt eine politische Mehrheit verkriegt.
Das heißt, es ist total schwer in dieser Regierung eine Politik für eine gerechtere Steuerpolitik durchzusetzen.
Damit muss man umgehen.
Das war allerdings tatsächlich Teil der Koalitionären Verabredung.
Und trotzdem muss man ja die Diskussion darüber führen, auch wenn die Erfolgsaussichten begrenzt sind.
Aber das ist doch bitte Herr Bovenschulte, oder?
Dann ist Opposition ja doch Gold.
Und nicht Mist, wie Franz Münteferrin gesagt hat.
Wenn man sich nur in der Opposition leisten könnte, tatsächlich mal eine Idee zu entwickeln, die der eigenen Programmatik entspricht und die auch der dem Wunsch vieler Menschen in Deutschland entspricht.
Fünfundsechzig Prozent der Befragten zum Beispiel haben jetzt im Infratest-Demop auch gesagt, sie wünschen sich Steuererhöhungen auf hohe Einkommen.
Einenfünfzig Prozent sprechen sich für eine Anhebung der Steuern auf hohe Erbschaften aus.
Also nicht etwa eine Absenkung, sondern eine Anhebung derselben.
Und wenn man dann sagt, ja, wartet mal ab, könnte es sein, dass es beim nächsten Mal klappt, dann ist das ja eine bittere Aussicht.
Und trotzdem gehört ja zur Realität.
Angesichts der Festlegung, wird man diese Steuererhöhung oder könnte man sie durchsetzen.
Und das kann weder die Opposition, noch können wir das gegen den Widerstand der Union machen.
Und das ist einfach die Realität.
Wenn Bürgerinnen und Bürger tatsächlich eine andere, eine gerechtere Steuerpolitik haben wollen, dann müssen sie auch die entsprechenden Parteien bei den Wahlen mit einer entsprechenden Mehrheit ausstatten.
Wenn die Mehrheiten so sind, wie sie jetzt sind, dann gibt es keine richtige Perspektive, eine solche Politik durchzusetzen in Deutschland.
Da muss man ganz nüchtern und ehrlich sagen, das ist einfach eine Frage der politischen Mehrheitsverhältnisse.
Was denken Sie?
Ja, da fallen wir ganz viele Sachen zu einem.
Das Erste, was mir dazu einfällt, weil er eben von den Mehrheiten spricht, es ist völlig unrealistisch, dass bei uns in Deutschland in absehbarer Zeit eine Partei die absolute Mehrheit haben wird.
Das heißt, wir werden immer Koalition Regierungen haben.
Das heißt, es wird nie sich nur eine Partei durchsetzen.
Das ist ja gerade, glaube ich, der Irrglaube, den manche CDU-Anhänger haben, dass sie denken, wir haben doch so viel mehr Stimmen bekommen, jetzt müssen wir da endlich mal wieder CDU pur machen können.
Natürlich können sie das nicht, weil sie haben ja nicht die absolute Mehrheit.
Nee, Und da ist es ganz egal, wie viel Stimmen die SPD bekommen hat.
Sie wird immer gebraucht und aktuell ist es ja die einzige Alternative, die es überhaupt gibt, die einzige Option.
Das heißt natürlich wird die immer auch was durchsetzen können.
Das war ja in der Ampelkoalition mit einer FDP auch so.
Die wurde ja gebraucht für diese Regierung und die hatte ja viel weniger Stimmen als die SPD jetzt hatte und trotzdem hat sie sehr viel durchgesetzt.
Also dieser Glaube, ja, endlich mal wieder pur das Parteiprogramm durchzusetzen.
Das wird mir nie durchsetzen, solange man nicht die absolute Mehrheit im Parlament haben wird.
Und ich fürchte das, oder was heißt ich fürchte, das wird nicht mehr passieren.
Insofern also, das können wir gleich mal abräumen.
Jetzt kommt die nächste Frage, das macht der Koalitionspartner nicht mit.
Ich glaube, jetzt geht es wirklich darum, wie kann man denn politische Kompromisse finden?
Ich habe ja am Anfang gesagt, wir versuchen, Vorschläge zu machen, die eigentlich richtig und gut sind.
An der Stelle geht es jetzt darum, die eine wollen keine Steuererhöhungen, die anderen wollen, dass die Rente nicht gesenkt wird oder dass es keine Angriffe gibt.
An der Stelle muss man sich jetzt hinstellen, muss sagen, die Zeiten sind schwierig und jetzt müssen beide was nachgeben.
Nicht im Sinne von, die einen verhindern die Steuererhöhung und die anderen sagen, aber trotzdem müssen die Renten weiter so steigen wie bisher.
Sondern im Gegenteil, jetzt müssten die einen sagen, okay, wir geben ein bisschen nach hier und ihr gibt ein bisschen nach hier.
Und das, indem man erst mal der Bevölkerung erklärt, wie schwierig die Lage wirklich ist.
Wir wollen keinen verunsichern und dafür sorgen, dass die sagen, okay, ich harte jetzt nur noch, weil das Weltuntergang nahm.
Nein, nicht.
Aber doch mal ...
Wahrheiten sagen, nämlich wir müssen jetzt uns mehr verteidigen.
Die Bedrohungslage ist ernster geworden.
Im Polen kommen russische Drohnen an.
Gerade heute, ja.
Das zeigt, wie real die Lage ist.
Wir werden von den Vereinigten Staaten nicht mit im gleichen Umfang diese Unterstützung bekommen.
Und zwar gewisserweise mit Recht.
Warum sollen die unsere Verteidigung finanzieren?
Wir sind als Europa reich genug, um das zu machen.
Also sprich, da werden wir jetzt mehr Geld für ausgeben.
Das wird uns ärmer machen.
Die Pandemie hat uns ärmer gemacht.
Die Energiekrise hat uns ärmer gemacht.
Und wir haben uns die ganze Zeit in die Tasche gelogen, in dem wir uns gesagt haben, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin.
Der Staat wird das schon irgendwie unterstützen.
Und das war natürlich richtig, dass der Staat in einem gewissen Umfang unterstützt hat, um das um es nicht von jetzt auf nachher alle massiv vor Probleme zu stellen.
Und natürlich wollte man nicht, dass die Menschen im Winter frieren, als die Heizkosten so hochfahren.
Aber man hätte auch damals sagen können, okay, das können sich nicht alle leisten, die müssen wir unterstützen, aber die allermeisten können sich das erleisten und dann müssen die nicht unterstützt werden.
In der Phase haben wir zum Beispiel damals gesagt, gut.
Technisch kriegen wir das nicht hin, dass wir differenzieren, wer hat wie viel Geld und dann unterstützt nur die Ärmsten.
Deswegen hat man es an alle ausgezahlt, aber wir haben damals in uns im Gutachten reingeschrieben, dann könnte man für diese begrenzte Zeit, wo es einerseits diese Energie-Subvention gibt, dann könnte man einen Soli verlangen von den Reisten und das heißt die geben einfach ein bisschen wieder von dem Geld ab.
Also ich habe Unterstützung bekommen für die Gasrechnung, ich hätte es nicht gebraucht, ich hätte diesen extra Soli zahlen können.
Das war übrigens genau der Fall, wo dann der Finanzminister sich umgedreht hat, bei der Gutachten Übergabe und gesagt hat, das mit uns ganz sicher nicht.
Wir werden nie und nimmer Steuernerhöhungen zustimmen.
Und das in einer Lage, wo jeder vernünftige Mensch gesagt hat, ja genau, das ist doch völlig offensichtlich, dass wir diese Unterstützung nicht brauchen.
Das Land ist ärmer, die Kosten sind so stark gestiegen, irgendjemand muss dafür aufkommen.
Das können nicht die Ärmsten sein, ja.
Das können aber auch nicht alles die Kinder später tragen.
Insofern also an solchen Stellen mal zu sagen, wie ernst ist die Lage wirklich?
Und wer kann das schultern und wie kriegen wir das gemeinsam hin?
Und dann müssen eben alle Abstriche machen.
Dann müssen halt auch die Rentnerinnen und Rentner Abstriche machen.
Da muss vielleicht ein Feiertag gestrichen werden.
wenn man die Liste der Grausabkeiten so wählt, dass alle irgendwo was abgeben müssen, alle irgendwo belastet sind.
Ich glaube, dann kann man diesen gesellschaftlichen Konsens hinkriegen.
Ich glaube, wir unterschätzen die Bereitschaft der Menschen, sich auf sowas einzulassen, weil man sie offensichtlich nicht ernst genug nimmt, um ihnen die Wahrheiten sozusagen.
Das wäre etwas, wo Koalitionäre zusammenkommen müssten.
Und zwar zu Beginn einer Koalitionsphase.
wenn in der Tat die Menschen noch die Chance haben, sich darauf einzustellen und dann halt auch das zu verdauen bis zur nächsten Wahl und dann vielleicht auch eingesehen haben.
Ja, das war auch richtig so.
Ich finde es einen guten Punkt, den Sie da sagen.
Ich glaube, das ist ja auch in, ich weiß nicht, ob man es übertragen kann, aber ich tue es jetzt einfach mal.
Wenn man mit jemandem in einen Konflikt geht.
Oder man hat einen Konflikt, man will ihn ansprechen.
Das macht man ja dann, wenn man denjenigen überhaupt ernst nimmt.
Man spricht gar nichts mehr an und Donner drüber und sagt, das hilft ja gar nichts, der ist ja gar nicht ernst zu nehmen.
Dann nimmt man denjenigen nicht mehr ernst.
Ich glaube, dass man das übertragen kann.
Ich glaube auch, mich erinnern zu können an die Stimmung, in dem Moment, den sie beschreiben.
Ich glaube, die Bereitschaft wäre groß gewesen, derjenigen, die es tragen können, dafür mehr Geld aufzuwenden.
Es ist dann versägt worden, glaube ich, durch diese Gaspreisumlage, wo man dann das Gefühl hat, da komme ich jetzt nicht mehr so ganz mit, was damit gemacht werden soll.
Das war handwerklich nicht gut.
Das war nicht durchdacht.
Und irgendwann stand Herr Haber ganz alleine damit da, auch wenn das eine Idee der gesamte Regierung, mindestens die auch von der SPD war.
So, das war blöd.
Da hat man was verrocknt, glaube ich, an gesamtgesellschaftlicher Stimmung.
Aber ich glaube eigentlich auch, dass man sie hätte jetzt wieder wecken können.
Aber das macht man natürlich so nicht, wenn man...
Herrn Woventschulte zuhört, wo ich denke, ja, okay, mich beeindruckt die Ehrlichkeit.
Das finde ich offen, dass er sagt, geht alles gar nicht, kann man mit dem Koalitionspartner nicht machen, nur sie hilft uns ja gar nicht.
Nein, natürlich nicht.
Aber deswegen wieder, also wenn überhaupt, dann sollte man solche Themen am Anfang einer neuen Legislaturperiode diskutieren und nicht am Anfang die Zuckerstückchen verteilen.
um dann später zu sagen, jetzt sind wir zu kurz vor der Wahl, das können wir auch nicht sehr ernsthaft das mehr reformieren.
Also die Reihenfolge stimmt einfach gerade gar nicht.
Nee, im Moment stimmt auch nicht, finde ich, die Konsistenz der Vorschläge, weil man hört ja, einerseits alles, was im Koalitionsvertrag steht, steht unter Finanzierungsvorbehalt, dann sagt man, es ist kein Geld dafür, die Strompreisabsenkung für alle.
Da fehlte, glaube ich, ungefähr fünf Milliarden.
Dann gab es einen Koalitionsausschuss, in dem über das gesprochen wurde.
Man sagt, nein, sorry, also ganz ehrlich, das wird nicht hinkommen, dass wir die Strompreis absenken.
Und wie versprochen für alle machen, steht ja unter Finanzierungshohel.
Im selben Koalitionsausschuss wird aber genau beschlossen, dass die Mütterrente ausgeweitet wird.
Und es kostet, guck mal, auch fünf Milliarden.
Wer soll denn da mitkommen?
Da fällt einem nichts, wenn zu einem.
Nicht erklärbar ist in der Tat.
Was wäre für Sie, Frau Schnitzer, eine echte Reform?
Wann ist das so?
Ich habe nachgeguckt, Bundeszentrale für politische Bildung erklärt für Dove.
Was ist eine Reform?
Das findet man vor allem in der Politik.
schreiben, die damit wird eine Umgestaltung bezeichnen, mit der man Dinge oder Strukturen verändert, ohne so gleich alles radikal anders zu machen, von lateinisch Reformare umgestalten.
Ja, genau so ist das.
Also man gestaltet etwas um.
Und die interessante Frage ist, wann gelingt es einem am ehesten so was zu machen, wenn der Ernst der Lage erkennbar ist?
Und vor allen Dingen dann, wenn die Menschen sehen, okay, so wird es ohnehin nicht weitergehen.
Denn eines muss man sich ehrlicherweise schon eingestehen.
Menschen lieben es nicht, dass Veränderungen auf sie zukommen und schon gar nicht.
Sie lieben es, wenn sie Angst haben, dass sie was verlieren.
Also Veränderungen an sich mögen die wenigsten.
Und Angst vor Verlusten ist auch besonders schlimm.
Wann ist es am ehesten möglich, die dazu zu bringen, dass...
...durch ein exterm Schock vielleicht?
Ja, genau.
Immer dann, wenn...
die Welt sich ohnehin verändert hat und man sieht, okay, so wie es jetzt ist, bleibt es ohnehin nicht, dann wird man eher die Menschen dazu bringen, sich damit anzufreunden, auf eine Veränderung sich einzulassen, in der Hoffnung, dass man dann doch noch was retten kann.
Also es gibt einen schönen Spruch von Churchill, Winston Churchill, der gesagt hat, never waste a good crisis.
Also nie eine Krise ungenutzt lassen, weil das sind die Chancen, das sind die Zeiten, wo man am ersten Mal was verändern kann.
Da wäre die Pandemie vielleicht nicht der beste Anlass gewesen, weil das war etwas, das war eine vorübergehende Krise.
Da hat man ja noch draufgesetzt, okay, wenn das mal vorbei ist, alle sind geimpft und das ist bekämpft eingedämmt, dann ist wieder gut.
Die Energiekrise wäre eine solche Krise gewesen.
Denn die Energiekrise hat bedeutet, die Energiekosten sind massiv gestiegen und sie sind nicht wieder zurückgegangen.
Wir sind ja nicht wieder beim wo russischen Gas gelandet, sondern wir importieren jetzt Gas als Flüssigas.
Das ist viel teurer.
Wir müssen jetzt selber andere Arten von Energie nutzen, die teurer sind insofern.
Also das war klar ein Umbruch.
Die Zeiten werden nicht mehr so sein wie früher, wo wir von günstigem Energie profitieren können.
Das ist jetzt nochmal ganz anders geworden durch die Vereinigten Staaten.
Die sagen, sie verteidigen uns nicht mehr durch Russland, die uns jetzt doch massiv bedrohen.
Das heißt, der Zollkrieg, den wir gerade erleben, China, die auf einmal bessere Autos produzieren.
Interessantere Autos, fortschrittlichere Autos, günstigere Autos.
Das heißt, an dieser Stelle erleben wir auch, die Welt hat sich massiv geändert.
Und eigentlich kommen da gerade genug Krisen zusammen, um den Menschen klar zu machen, es wird sich was verändern.
Und wenn wir uns jetzt nicht bewegen, dann werden wir überrannt von all diesen Entwicklungen.
Das heißt, jetzt, wenn man Zeit sich wirklich aufzustellen, muss ich was ändern.
Aber scheint ja nicht zu wirken.
Also, sonst käme doch auch eine Bundesregierung nicht durch damit, dass sie sagt, naja, wir haben ja jetzt ganz viel auf die Reise gebracht.
Wir haben übrigens auch ganz tolle Kommissionen gebildet.
Die werden sich dann zusammensetzen und die finden...
ganz tolle Vorschläge, mit denen wir dann sowohl den Sozialstaat modernisieren können, als auch die Rente reformieren können und so weiter und so fort.
Also irgendwie lässt man sich doch vertrösten.
Ja, ich fürchte, wir sind jetzt in einer Situation, wo die Koalitionspartner sich nicht mehr so ganz trauen, diese harten Ansagen zu machen, weil es andere Parteien inzwischen gibt eine ganz besonders, die mit sehr einfachen Geschichten denkt, die Menschen abholen zu können, die dann sagen, okay, schmeißen wir nur die Ausländer raus, dann wird das schon besser.
Wir müssen ja gar nicht uns von Russland bedroht fühlen, die wollen ja gar nichts von uns.
Also das heißt, die wirklich mit sehr einfachen Geschichten.
einige Menschen zumindest davon überzeugen, wir müssen gar nichts ändern.
Nein, im Grunde müssen wir ja einfach nur dafür sorgen, dass wir jetzt kein Bürgergeld bezahlen und wie gesagt auch keine Flüchtlinge mal aufnehmen.
und das mit Russland ist schon nicht so schlimm.
Wenn man Sorge hat, dass die sich durchsetzen, weil man mit seiner eigenen Geschichte nicht durchkommt, weil man die Menschen nicht von der eigentlichen Wahrheit überzeugen kann, dann wird das schwierig.
Umso wichtiger wäre jetzt, Auch hier die Menschen ernst zu nehmen und ihnen ganz klar vor Augen zu führen, doch es ist eine Bedrohung.
Und doch wir verteidigen uns letztlich auch mit der Ukraine.
Wir geben denen nicht das Geld für nichts und wieder nichts, sondern weil wir sehen, dass die Bedrohung massiv steigt.
Und wie gesagt, wir müssen für den demografischen Wandel Vorsorge treffen, etc., etc.
Ich glaube, man unterschätzt auch an der Stelle wieder, dass die Menschen das doch verstehen können.
Es ist mir auch klar, natürlich will man niemanden so verunsichern, dass sie sagen, um Gottes Willen, was soll jetzt noch alles mit uns passieren.
Man muss auch eine gewisse positive Wendung dem Ganzen auch geben, indem man vermittelt, wie wir es denn schaffen können, also wie wir aus der Krise rauskommen können.
Aber trotzdem muss man es angehen.
Wir haben die Folge ja genannt, wie ist der Kollaps des Sozialstaats noch zu verhindern.
Das klingt jetzt nicht so durchgängig positiv.
Das stimmt.
Aber wir pflegen in unseren Folgen, immer einen konstruktiven Schlusspunkt zu setzen.
Und da würde ich dann gerne das aufgreifen, was Sie gerade gedacht haben.
Ein Beispiel dagegen setzen Schweden, nämlich die nehmen wir das Beispiel Ihre Rente jedenfalls, so glaube ich, in den Augen der meisten, sie verstehen mehr davon, vorbildlich organisiert haben.
Das könnte man sich als Beispiel nehmen.
Demografisch habe ich mir nochmal angeschaut sind, dass Schweden und Deutschland nicht zu hundert Prozent vergleichbar.
Schweden hat ein niedrigeres Durchschnittsalter in der Bevölkerung, als wir das haben, dafür aber eine höhere Lebenserwartung, noch höhere Lebenserwartung, als wir in Deutschland haben.
Heißt, der demografische Wandel schlägt in Schweden nicht gar so stark zu wie hierzulande.
Aber trotzdem drauf geschaut, inwieweit Schweden was umsetzt, was wir auch machen könnten, inwieweit das also zu einem Vorbild taugt, was die richtig machen, dann fällt auf wichtig ist, dass sich die Schweden seit dreißig Jahren vorbereitet haben.
Die haben sehr viel früher gesehen, was Phase ist.
Und seit diesen dreißig Jahren sind die Menschen aufgefordert, in Teil ihrer Rentenbeiträge automatisch in einen Aktienfonds fließen zu lassen.
Mit dem Ergebnis aber, dass sich dieses Geld in achtundzwanzig Jahren vervierfacht hat.
So dass jetzt die Renten höher und die Beiträge stabil sind.
Die zahlen auch, achtzehn Komma fünf Prozent ihres Ein- ihres Gehalts, wir achtzehn Komma sechs Prozent und zweieinhalb Prozent.
Ein kleiner Teil davon fließt eben verpflichtend in diesen Aktienfonds.
Da kann man sich aussuchen, welchen man toll findet, hat eine Auswahl unter mehr als hundert Fonds, kann aber auch den staatlichen Standardfonds nehmen, wenn man gar keinen Bock hat und ich weiß, wie man sich jetzt woran orientieren könnte.
Das ist also eine Mischung, die die haben aus einem Umlageverfahren und einer Kapitaldeckung.
Auch die Beamten, wie Sie und die Selbstständigen, sind einbezogen.
Die betriebliche Altersvorsorge haben die sehr viel stärker ausgebaut, als wir das in Deutschland haben, wegen der hohen Tarifbindung dort.
Auch neunzig Prozent der Beschäftigten sind in den vier betrieblichen Versorgungswerken, da abgesichert.
zusätzlich noch.
Und die Arbeitgeber übernehmend aber einen deutlich größeren Anteil der Finanzierung als in Deutschland.
So Kritik daran ist sicherlich immer die Was wir in Deutschland auch gerne sagen, lasst mal lieber nicht machen.
Schwankungen auf den Kapitalmärkten könnten auch zu Einbußen dann bei den Ansprüchen führen.
Das gab es in Schweden auch schon in den Jahren, äh, zwanzigzehn, elf und vierzehn.
Da gab es dann auch nominale Rentenkürzungen, die allerdings dann ausgeglichen werden konnten, weil das nicht so gigantisch war, dass es Schweden vollständig befordert hätte.
Ist das ein Vorbild, wo wir sagen können, yeah!
Wir haben ein Beispiel.
Wir orientieren uns nicht nur beim Wehrdienst an der Freiwilligkeit, die das schwedische Modell vorsieht, sondern auch in der Rente.
Unbedingt, unbedingt.
Das ist ein Vorschlag, den wir in unserem Gutachten vor zwei Jahren, als wir uns ganz intensiv mit der Rente auseinandergesetzt haben, ganz, ganz stark gemacht haben.
Das ist also zumindest ein Teil der Beiträge.
letztlich dann zusätzlich, weil der Rest wird ja gebraucht, momentan um die Rentenauszahlung zu finanzieren, aber dass man einen Teil jetzt wirklich im Grunde selbst anspart in diesem Aktienfonds und davon später auch was hat.
Die Renditen sind um ein Vielfaches höher, wie das, was die Menschen bekommen, wenn sie einfach ein Sparprodukt haben.
Also sprich, wenn sie das Geld auf die Zersparkasse bringen, war ja in den letzten Jahren überhaupt keine Verzinsung.
Oder wenn sie eine Lebensversicherung abschließen, das sind alles Dinge, die eine sehr viel niedriger Rendite haben.
Also die Inschäden hatten acht, neun Prozent Rendite.
Das ist wirklich massiv.
Das heißt, wer das hatte, der hat auch wirklich sehr profitiert.
Wir sind mit diesem Vorschlag.
Natürlich auch unterwegs gewesen und wiederum ist man dann in der damals nach Ampel in Teilen der Regierung eben gar nicht auf Zustimmung gestoßen.
Genau aus dem Grund, den Sie mir schon angesprochen haben, der wurde deutlich vorbehalte geäußert.
Ja, meine Güte, der Aktienmarkt, das ist doch was nur für Spekulanten.
Da kann man doch auch all das Geld verlieren.
Da muss man sagen, haben die Menschen in Deutschland einfach auch schlechte Erfahrungen gemacht.
an verschiedenen Stellen.
Lassen Sie mich das erste Beispiel bringen.
Wenn es ältere dabei sind, die zuhören, die werden das noch wissen.
Als die Telekom privatisiert wurde, wurde ein damals sehr populärer Schauspieler in die Bütte geschickt und der hat dafür Werbung gemacht.
Viele haben das gekauft.
Eine ganze Reihe von Menschen haben Geld verloren, weil sie zu einem hohen Zeitpunkt eingestecken sind und dann ist er wieder in den Keller gerauscht und dann haben die Geld verloren.
Das zeigt aber...
– Wollt ihr hoffen, war das, oder?
Oder früher?
– Ja, das war sogar noch früher, ne?
Das war's in der Nuanziger gewesen, gerne.
– Tragen wir nach.
– Der Punkt an der Stelle ist, was ein richtig großer Fehler ist, ist, wenn man nur auf eine Aktie setzt.
Das ist genauso, wenn ich sage, ich kaufe jetzt Biontech, aber zum höchsten Kurs, oder ich kaufe jetzt, na ja, weil mir jetzt gerade Apple gefällt.
Manchmal hat man Glück, ja, dann kann das gut gehen, aber in aller Regel kann es halt auch mächtig schiefgehen.
Was aber eine wirklich...
Bomptensichere Anlagestrategie ist, es breit diversifiziert zu investieren und auch nicht nur in Deutschland oder nicht nur in Europa weltweit.
Dafür gibt es inzwischen tolle Produkte, es gibt Fonds, ETFs, wo man das genau machen kann.
Und die Anlagen sind wirklich auf Dauer extrem sicher.
Das kann im einen Jahr mal runtergehen, aber wenn ich mit dreißig Anfangen in diese Art zu sparen, Dann habe ich fünf, dreißig Jahre, vierzig Jahre, bis ich dann das später mal wirklich brauche.
In der Phase werden sich die Auf- und Abs ganz gut ausgleichen.
Und gegen Ende kann ich auch rausgehen aus den Produkten und es dann wirklich sicherer anlegen.
Aber in der Zwischenzeit habe ich hohe Renditen erzielt.
Das ist etwas, was man erklären muss, was mit Erklären vielleicht manchmal auch alleine gar nicht getan ist.
Wir haben deswegen damals auch vorgeschlagen.
ein Kinderstaatgeld einzuführen, Kindern zwischen sechs und achtzehn, jeweils zehn Euro vom Staat zu geben, die dann genau in diese Produkte, monatlich, die dann genau in solche Produkte investiert werden, damit die Kinder erfahren, wie so was funktioniert.
Denn man kann das zwar einmal im Unterricht erklären, aber das ist ja dann hier rein und daraus, also das nutzt gar nichts, aber das erfahrbar zu machen.
Und interessanterweise, dieser Vorschlag hat dann Eingang in den Koalitionsvertrag gefreut, nämlich ...
als sogenannte Frühstaatrente.
Also unsere Hoffnung ist, dass sich das nun auch wirklich so umsetzt.
Das heißt, dass dieses Programm gestartet wird, damit die Kinder das erleben.
Denn wer nicht von zu Hause das mitbekommen hat, weil die Eltern selber schon so anlegen, ja, wo soll der das denn lernen?
Und nochmal, wie gesagt, nur einmal erklären, das reicht nicht, das muss man wirklich erleben.
Auf die Weise könnte man diese Vorbehalte wirklich...
reduzieren, die Menschen erleben, die jungen Leute erleben und die Eltern dann auch mit.
Das nächste, was man an der Stelle natürlich aufpassen muss, ist, dass die Gebühren nicht zu hoch sind.
Denn wir hatten ja tatsächlich schon mal diesen Ansatz.
Mit der Riesterrente?
Mit der Riesterrente.
Da hat man aber ein paar sehr massive Fehler gemacht.
Der erste wichtige Fehler, fatale Fehler, war, dass man gesagt hat, dass das, was eingezahlt wird, das muss man mindestens wieder rauskriegen.
Also jede solche Garantie bedeutet, dass man extrem eingeschränkt ist, wie man investiert.
Und das bedeutet, erstens wurde ständig umgeschichtet, was enorme Gebühren verursacht.
Und die Rendite sind auf die Weise sehr viel reduzierter.
Also wenn man dieses minimale Risiko zulässt, dass die Beiträge nicht alle wieder zurückkommen, dann sind die Rendite...
Das war ein großes Risiko, das wäre ein Totalausfall.
Ja, aber der Punkt ist eben...
Auf Dauer, also über einen sehr hohen Zeitraum ist das quasi nicht existent von einem Jahr auf das nächste.
Ja, da kann es mal runtergehen.
Aber wenn ich es so breit diversifiziert habe, dann wird das nicht in allen Bereichen so runtergehen.
Die einen werden profitieren, die anderen eben nicht.
Und dann geht es auch danach wieder hoch.
Aber mit einer solchen Garantie hat man das massiv reduziert, die Rendite, die man da erzielt hat.
Und das nächste, was ein großer Fehler war, Man hat das von Anbietern anbieten lassen, die enorm hohe Gebühren verlangt haben.
Sprich, da gab es zu wenig Wettbewerb.
Deswegen im schwedischen Fall gibt es dieses Staatsprodukt, was praktisch zum Nulltarif zur Verfügung gestellt wird, weil das alles im Grunde automatisch ausgesucht wird, wie wird investiert, einfach nach dem Index.
Wenn man ein solches...
Produkt hat, dann können es auch noch jede Menge private Produkte geben, aber dann müssen sie sich an diesem sehr, sehr niedrigen Gebühren orientieren.
Da müssen sie schon was Tolles bieten, damit sie auch noch Gebühren dafür kriegen.
Und das bedeutet, man hat ein sehr viel attraktiveres Produkt.
Das ist der Witz an diesen hundert Fonds, zwischen denen man auswählen kann, dass man eine Art von Wettbewerb sofort mit rein erzählt.
Und dass die Gebühren dann sehr viel niedriger sind.
Das schwedische Vorbild, sagen Sie und haben Sie auch schon gesagt, das könnte es sein.
Aber ich will jetzt nicht wieder alle die gute Stimmung in den Keller reiten.
Es müsste eine politische Bereitschaft dazu geben.
Ich setze mal darauf, dass das mit dieser Frühstadtrente wirklich ins Laufen kommt.
Und das ist da ein Folgeprodukt, der gibt.
Wenn ich ihn im Achtzehn sehe, sollen die ja weitermachen, dass man dann Anschlussprodukte hat.
Schlussfrage bei uns ist immer, dass wir nochmal die Folgenfrage nehmen, in dem Fall, wie ist der Kollaps des Sozialstaats noch zu verhindern?
und dann fragen, wo stehen wir da in einem Jahr?
Wer, wenn nicht sie, weiß sowas.
Also mein realistischer Einschätzung ist, in einem Jahr haben wir eine Kommission, die sich über solche Sachen Gedanken macht.
was die Rente anbietet.
Ja, das hätte ich jetzt auch sagen können.
Das weiß ich ja schon.
Da würde ich einfach nur sagen, die bräuchte es gar nicht, weil die Vorschläge liegen alle auf dem Tisch.
Wir haben sie alle aufgeschrieben.
Und das gleiche gilt für die Pflege.
In einem Jahr werden die Vorschläge, der aktuell schon amtierenden Kommissionen auf dem Tisch legen, kann ich wiederum sagen, kann man sich viele schwanen, weil schon viele Vorschläge auf dem Tisch legen.
Ja, ich arbeite daran, dass die Lage in einem Jahr besser aussieht als das, was man so normalerweise erwarten würde.
Schauen wir mal, ob der Podcast dabei hilft.
Das hoffe ich sehr.
Jedenfalls danke ich Ihnen total, dass Sie da waren.
Auch, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in die Arbeit des Sachverständigenrates und uns auch zugegeben haben, dass der mitunter die Fassung verliert bei dem, was sich politisch zeigt.
Aber genau, hilft ja nichts.
Man muss da dran bleiben.
Man muss weiterarbeiten.
Man muss auch weiter, dass so verstehen Sie Ihre Rolle aufklären und sagen, so ist das.
Und das könnte man machen.
Das haben Sie heute hier.
digital.
Vielen Dank dafür, wirklich super nett, dass sie sich nach so einem langen Tag noch so viel Zeit genommen haben, finde ich ganz und gar nicht selbstverständlich.
Danke schön.
Ja, ich bedanke mich.
Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der zehnte September um zwanzig Uhr, das haben wir so glaube ich auch noch nicht gesagt.
Redaktion hat gemacht Sven Knoblauch, Executive Producerin, Marie Schiller, Producer Lukas Hambach und Patrick Zahn, Sounddesign, Hannes Husten, die Vermarktung macht für uns die Mitvergnügen, sprich wer bei uns Werbenbilder kann sich an die wenn und das ganze ist eine Produktion der Willmedia.
Vielen Dank.