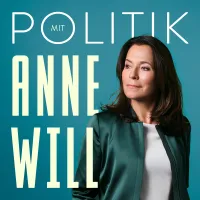Episode Transcript
Wie höhst du Sprachnachrichten ab, wenn du dann welche bekommst, gelassen, genervt mit anderthalbfacher Geschwindigkeit, am liebsten gar nicht?
Oder wie machst du das?
Ziemlich altmodisch, genervt.
Ich denke, warum können die jungen Menschen nicht mehr telefonieren?
Ach so, du würdest lieber telefonieren, ja?
Ich würde lieber telefonieren.
Das meiste lässt sich, das ist ja wie so ein Zeitverzöger, das telefonieren.
Also eine Telefonierverweigerung, die oft was wahnsinnig ineffektives hat.
Also man schickt dann 13 mal irgendeine Sprachnachricht hin und her, um etwas sehr Simples zu leisten, nämlich eine Verabredung, die sich in einem tatsächlichen Dialog mit sofort austauschen, unmittelbar klären wie sie.
Wir wollen über das Zuhören sprechen, Bernhard, und da spielt sowas auch eine Rolle.
Schön, dass du da bist.
Was könnte es eigentlich für ein besseres Thema für einen Podcast geben, als das Zuhören?
Ich glaube, das geht eigentlich gar nicht besser.
Deshalb freue ich mich total, dass nicht nur ihr dabei seid und uns zuhört.
Herzlich willkommen dazu freut mich, sondern das Bernhard Perksen.
Unser Gast ist, der ein ganzes Buch über das Zuhören geschrieben hat, Untertitel "Die Kunst, sich der Welt zu öffnen".
Herzlich willkommen, Bernhard.
Freue mich, dass du da bist.
Wunderbar, ich freue mich auch sehr.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst und nicht du zu dich, denn wir kennen uns.
Aber manche unserer Hörerinnen und Hörer hat dich auch schon gelesen, gehört im Fernsehen gesehen, kennt vielleicht manche eine deiner Arbeiten.
Ich will dich aber dennoch vorstellen, du bist Professor für Medienwissenschaft in Tübingen an der Universität dort.
Du arbeitest seit langem an den Fragen gelingender Kommunikation guter Gespräche über die Kunst des Miteinanderredens, wie eines deiner Bücher heißt.
Hast du gleich aber auch über mislingende Kommunikation oder aber Krisenkommunikation, die auch mislingen kann, gerade im Verlauf von Skandalen oder Affären viel geforscht, hast über die gesellschaftlichen kommunikativen auch Kommunikationszerstörenden Folgen der Digitalisierung nachgedacht, nun also dein Buch über das Zuhören.
Dafür hast du, habe ich verstanden, zehn Jahre lang gebraucht.
Warum?
Was hat dich da aufgehalten?
Ich glaube, ich habe mich letztlich selbst aufgehalten.
Also ich habe schon 2015, 2016 über diese Themen nachgedacht.
Welche Formen des Zuhörerns gibt es eigentlich getrieben von so einer gewissen Faszination?
Was macht das Zuhören eigentlich zu so einer elementaren von Kommunikation?
Man kann ja eines mit Gewissheit sagen.
Ohne wirkliches Zuhören ist alles nichts.
Gibt es kein Podcast, gibt es kein Miteinanderreden, gibt es keinen ausreichend respektvollen Streit, gibt es keine Versöhnung, gibt es gar nichts.
Aber ich selbst habe mich so schwer getan mit diesem Thema, weil im Hintergrund dieses Buches ein persönliches Erleben steht.
Ich würde sagen, selbstkritisch sagen, ich habe in einem sehr entscheidenden Moment meines Lebens nicht genau genug zugehört, nicht genau genug hingehört und bin sozusagen vertraut geworden mit der ungeheuren, einmal menschlichen Neigung zur Ignoranz.
Das beschreibst du im Übrigen auch im Buch, glaube ich, wenn ich dich richtig da verstanden habe, eine Situation, die ausschlaggebend war.
Du umkreist, so schreibst du, endlos ein diffuses Zentrum des Themas und ziehst dich dann mit einem Freund drei Tage lang in ein Hamburger Zimmer zurück, prallst erstmal mächtig damit, was du alles gelesen hast mit deinem Bücherwissen, mit Studien, Statistiken, die du in und auswendig kennst.
Welche Bücher du gut fandst, wenige Bücher gut fandst und er hört dir auch geduldig zu, fragt aber dann immer mal zum Teil auch hart, so beschreibst du das und zupackt nach, dass du und bist du endlich auf den Trichter kommst, dass du von dir selbst erzählen musst.
Warum war das der witz für ein Buch, was dann fäsig aber nicht von dir handelt?
Weil ich verstanden habe, dass dieses persönliche Sprechen absolut entscheidend sein kann, ich will das mal konkret machen, ich stand 2007 in der Wohnung meiner Eltern an dieser alten Kirschholzkommode, bin einem Buch geblättet, das ehemaligen Starrpädagogen Hartmut von Hintig, inzwischen tief gefallen und laß da so herum und war abgestoßen angewidert von dieser Angeberprosa, ich kannte sie alle, die Döhnhofs, die Kichtstee, Weizigas usw.
Also ein akademisches Angeberturm und es gab bei der Lektüre dieses Buches so für mich ein merkwürdiges Leben, man kann ja manchmal auch nicht gesagtes, halbgesagtes, nicht wirklich gesagtes hören, gleichsam zwischen den Zeilen hören, hören, was Wunder oder zwischen den Worten liegt und ich habe mich gefragt bei der Lektüre, wer ist eigentlich dieser lebensgefährte von Hartmut von Hintig, Gerhard Becker, ich hatte den Namen noch nie gehört, der da als pädagogisches Wunderwesen gefeiert wird und habe dann aus einer Intuition heraus begugelt und festgestellt im Netz ist, dass dieser Mann anders als im Buch kein pädagogisches Wunderwesen, sondern ein schwerer Missbrauchstäter, der Haupttäter an der einst gefeierten Odebendballschule, einer Schule im stillen Tal von Oberhambach und ich ab intuitiv den Missbrauchsbetroffenen, die sich da im Netz artikulierten geglaubt, dann ein paar Monate lang in den bekannten Kreisen zwischen Hintig und meiner Familie, die sich irgendwie überschnitten nachgefragt und nachgeforscht und das Thema irgendwie aufgrund all der hingehauchten Appelle, jetzt lass mal, es ist schwierig, es ist eklig, wieder fallen gelassen.
2010 ist es dann zum Skandal explodiert, da hat ein junger Reporter der Frankfurter Rundschau eigentlich ein Artikel, den er 1999 schon einmal veröffentlicht hatte, nämlich Missbrauch durch Gerald Becker an der berühmten Odebendballschule nochmal veröffentlicht.
Und da war auf einmal das Thema da, denn 1999 war alles in der Öffentlichkeit, in der Frankfurter Rundschau publiziert, lag alles offen da, keine Zeitung hat sich darum gekümmert, niemand hat es aufgegriffen, ein merkwürdiger Fall des gesellschaftlichen Nichts zu hören.
2010 veröffentlichter selber Reporter Miramina den selben Artikel noch einmal und auf einmal maximale Aufregung, alle Leitmedien greifen die Geschichte auf, Tausende von Publikationen.
Und in dieser Zwischenzeit, zwischen 1999 und 2010 ist so etwas entstanden, was man eine kollektive Zuhörbereitschaft nennen könnte.
Wie ist es passiert, der Langstreckenlauf der Betroffenen unendlich wichtig, eine Schulleiterin, die auf einmal die Tür öffnet, auch weil sie eine persönliche Geschichte mit dem Thema hat, eine veränderte gesellschaftliche Wahrnehmung, Menschen, die registrieren, dass eben Priester und auch die hohe Priester der Reformpädagogik fehlbar sein können aufgrund all der Missbrauchsberichte, die man gehört hat, über die Kirchen.
All dies spielt zusammen ein neues Medienzeitalter, Social Media Betroffene können sich in einem Blog vernetzen oder über Facebook oder über andere soziale Medien treffen und aneinander Kraft geben.
All dies spielt zusammen.
Und meine eigene Frage, warum habe ich selbst damit damals nicht genau hingehört, warum bin ich nicht meine Intuition gefolgt, wie funktioniert das gesellschaftliche Zuhören, wie kann es sein, dass eine Gesellschaft so lange etwas wissen kann und doch ignoriert.
Meine eigene wissende Ignoranz und die wissende Ignoranz der Gesellschaft, die hat mich unendlich beschäftigt und deswegen musste ich das am Beginn dieses Buches, obwohl es mir als Wissenschaftler unendlich schwer gefallen ist, persönlich zu schreiben, in Eichform zu schreiben, eine biografische Geschichte zu erzählen, auch weil ich denke, ich bin letztlich nicht wichtig.
Aber wurde mir klar, ich muss dies tun, weil eigentlich das Zuhören eine höchst private, oft unsichtbare Angelegenheit ist.
Es ist ja so in unserem Inneren dann so ein Austragungsprozess.
Wollen wir dem anderen glauben, welche Risiken hat das, wenn wir wirklich zuhören, was passiert mit dem eigenen Image oder der Wahrnehmung von Person oder Institutionen, die man gerade noch verehrt hat, wenn man wirklich zuhört und die Zentralthese, also ganz kurz, es gibt eigentlich zwei Formen des Zuhörens, zwei Formen der Aufmerksamkeit, eine von der egocentrischen Aufmerksamkeit, ein Ich-Ohr-Zuhören, orientiert an der Frage, erscheint mir das, was mir der andere sagt, plausibel.
In Wahrheit hört man sich vor allem selbst, geleitet von der eigenen Perspektive, den eigenen Filtern.
Und dann gibt es einen, würde ich sagen, Du-Ohr-Zuhören, nicht egocentrische Aufmerksamkeit, geleitet von einer ganz anderen Frage, nämlich in welcher Welt ist das, was der andere mir sagt war, in welcher Welt stimmt es, in welcher Welt ist es plausibel?
Also den anderen in seiner Andersartigkeit zu erkennen, in seiner Schönheit, in seiner Fremdheit und seinem Schrecken.
Darum geht es eigentlich beim wirklichen Zuhören.
Ich verstehe Zuhören in diesem Sinne als ein Bild oder seine Metapher für Offenheit.
Wie geht wirkliches echtes, wie geht gutes Zuhören, das will ich in dieser Folge mit Dir besprechen.
Wie macht man das andersrum?
Warum genau soll gutes Zuhören eigentlich so schwer sein, wenn wir doch dauernd jemandem zuhören und uns eigentlich in Wahrheit permanent darin üben, auch üben könnten, die jeweils andere Perspektive desjenigen einzunehmen, mit dem wir da gerade sprechen, so wie Du es schon angedeutet hast, was ich gleich vertiefen will mit dem Ich und dem Du-Ohr.
Was hindert uns daran, uns gut zuzuhören, uns mit der Position eines oder einer anderen respektvoll gründlich und differenziert auseinanderzusetzen und eben nicht auf Verkürzungen, Verzerrungen und Kampagnen reinzufallen.
Das interessiert mich in dieser Woche auch ganz besonders.
Heute ist der 17.
Juli 2025, in der wir ja beobachten.
Das hat eine riesige Aufmerksamkeit gefunden.
Zu Recht, wie ich finde, weil es unwahrscheinlich viel schichtig ist, was wir da jetzt gerade erleben und von großer Tragweite, wie ich meine.
Also wir beobachten, wie mit der Rechtsprofessorin Frau Kebrosius Gerstoff umgegangen wird, der, so denke ich, genau nicht aufmerksam und gründlich zugehört worden ist.
Ich denke, das ist eigentlich auch, weil es heute so prima passt, ein wirklich gutes Beispiel für es nicht zuhören.
Denkst du auch?
Ja, dem stimm ich zu.
Man sieht hier die Wirkung einer Desinformationskampagne, die ungeheure Geschwindigkeit, mit der eine gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit und Lichteröffentlichkeit stehende Professorin sich auf einmal in eine vermeintlich betrohliche, potenzielle Bundesverfassungsrichterin verwandelt, verwandelt wird.
Und man sieht hier auch, wie solche Feindbilder, Aufbauschungen aus dem Kontext gerissene Zitate, Äußerungen, dann ein Image umprägen und formatieren.
Und jetzt haben wir in der Ampelkoalition einen weitgehend unlösbaren Konflikt.
Die SPD hat sich festgelegt, die CDU hat sich festgelegt, März und Spahn haben erkennbar kaum Gespür für die Stimmungen in der eigenen Partei unter den einzelnen Abgeordneten.
Und ich stimme den zu.
Es ist in der Tat ein Beispiel für misslingende, entgleisende, von Diffamierung gezeichnete Kommunikation.
Aber, und ich versuche es ja immer, aus einer doppelten oder auch leicht wissenschaftlich Perspektive zu beobachten.
Es ist auch ein Beispiel, wenn wir Frau Prosius Gerstoff nehmen, wenn wir ihre Krisenkommunikation betrachten, auch ein Beispiel gelungener Krisenkommunikation.
Sie hat eigentlich alles gemacht nach einem Lehrbuch von Krisenkommunikation.
Sofort, gegengehalten, interveniert, ganz unterschiedliche Plattformen gesucht, abwägend auch manche Formulierungsschwäche eingeräumt.
Das ist also in vielerlei Hinsicht aufschlussreich zu beobachten.
Finde ich auch.
Deshalb bist du da auch so ein idealer Gesprächspartner für, weil du dich mit vielen Ebenen der Kommunikation, etwa auch der Krisenkommunikation im Laufe von Skandalen oder Affären beschäftigt hast.
Ich will noch mal kurz nacherzählen und dann auch mit dir die Frage diskutieren, ob es wirklich im politischen Raum oder für den politischen Raum jetzt eine gute Entscheidung war, wie sie sich verteidigt.
Da gibt es ja auch Gegenstimmen.
Aber vielleicht kurz noch mal nacherzählt.
Wir haben zwar da schon eine Folge zugemacht, diese Woche mit Feid Medik, die empfehle ich euch auch.
Aber für alle, die nicht die Zeit dazu hatten, Brosius Gerstdorf sollte im Bundestag als eine der drei Richterinnen für das Bundesverfassungsgericht gewählt werden.
Vorgeschlagen hatte sie die SPD und der dafür zuständige Wahlausschuss hatte sie auch schon mit zwei Drittel Mehrheit gewählt, auch mit den Stimmen von CDU und CSU, was später wichtig wird.
Dann baut sich aber seit anderthalb Wochen immer mehr Widerstand gegen Brosius Gerstdorf, vermeintliche Positionen auf, muss man sagen, vermeintliche Positionen in Sachen Impfpflicht, Kopftuchverbot für Staatsbedienstete, AfD-Verbot, hauptsächlich aber in Sachen, und das ist ein hoch emotionalisierbares Thema, wird immer wieder auch von Rechtspopulisten genutzt, um Stimmungen zu machen oder aber um eigenes Denken ins Werk zu setzen.
Also hauptsächlich hat Widerstand ausgelöst ihre vermeintlichen, das ist so wichtig, Positionen in Sachen Menschenwürdigarantie und Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen.
Und das eben auch in der Bundestagsfraktion der Union, außerdem bei manchen Kirchenvertretern der AfD, in rechtspopulistischen Medien, in extremen rechten Netzwerken, die Frau Brosius Gerstdorf gezielt falsch verstehen wollen, verunglimpfen wollen und das klare Ziel haben, dass sie ihre Wahl zur Verfassungsrichterin verhindern wollen.
Das ganze Gipfelte dann darin, dass sie in Spanien und Friedrich-März die Wahl der Verfassungsrichter*innen ins B kurz vor knapp abgeblasen haben und auf irgendwann, weiß nicht wann, vertagt haben.
Ein Desaster muss man sagen, nicht zuletzt auf dem Rücken einer hoch angesehenen Wissenschaftlerin ausgetragen, die verunglimpft wird, die gedemütigt wird, die andauernd und immer fort superverkürzt verstanden wird, wie wohl das ihr Denken auszeichnet, dass sie komplex denken kann, dass sie sauber abwägt.
Man hätte es vielleicht verhindern können, dass es soweit gekommen ist, wenn man Frau Brosius Gerstdorf wirklich gut zugehört hätte, sich mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit als wissenschaftliche Arbeit beschäftigt hätte, auch mit ihrer Rolle als Wissenschaftlerin.
Sie ist ja keine Politikerin, sie ist eine Wissenschaftlerin, die dann einen Rollenwechsel vornehmen wird, dessen sie sich sehr bewusst ist.
Glaubst du, man hätte es verhindern können oder ist diese Kampagne, du siehst eine Kampagne da, so wirkmächtig, dass das alles gar nichts mehr geholfen hätte, dann wäre das ja ein ganz finsterer Befund für nächste Personalfragen.
Nun in der Tat, also ich persönlich sehe wenig Auswirkmöglichkeiten, wenn sich einzelne Player entschieden haben, nun mit dieser Härte, dieser Wucht und auch dieser Bereitschaft, einzelne Positionen zu verzerren.
Das sind ja auch Positionen, an denen man durchaus im Einzelnen die Debatte über die Impfpflicht auch Kritik haben kann, das würde ich auch sagen, da hätte ich sofort der Differenz, oder sie würde vielleicht auch heute manches anders formulieren und hat ja auch genau dies angedeutet.
Aber wir sehen hier am Grunde genommen aus meiner Sicht, wenn ich das sozusagen kommunikationsanalytisch betrachte, so ein Übergang von der Mediendemokratie alten Types, organisiert und mächtige politistische Machtzentren, klassische Zeitungen herum, zu dieser Empörungsdemokratie der digitalen Gegenwart.
Auf einmal haben wir eine ganz große Erregungsarena, auf einmal können die ganz unterschiedliche Player mitspielen.
Das ist auch mal unabhängig von diesem Beispiel, nicht nur schlecht, das ist gut, wenn viele Menschen eine Stimme haben.
Aber wir sehen Leute, die eine E-Mail-Kampagne starten mit diesen vorgefertigten E-Mails.
Wir sehen einzelne Portale, die unglaublich hart und mit einer großen Intensität nachsetzen.
Wir sehen die Versuche auf die Bundestagsabgeordneten massiven Druck auszuüben und es passiert etwas, was man vielleicht so eine symbolische Aufladung einer Person nennen könnte.
Also auf einmal wird das zu einer prinzipiellen Lebens- und identitätspolitischen Entscheidung.
Wie stehe ich zu ihr?
Wie stehe ich zu ihrer vermeintlichen Aussagen, die es die Abtreibungsdebatte erwähnt, so nicht gegeben hat und alle Beteiligten werfen sich nun mit Macht in die öffentliche Arena.
Auch das ist ein Konfliktverschärfungsmittel bei Excellents, also Geschwindigkeit, je schneller die Überhitzung, das zu intensiver der Konflikt und alle werfen sich im Licht der Öffentlichkeit in die Debatte hinein.
Also je öffentlicher, das so schwieriger wird es auch, eine Position wieder zu nourcieren, abzuräumen, der Erzbischof, der sie ja in furchtbarer Weise angegriffen oder attackiert hat.
Eigentlich eine Äußerung, von der man kaum noch herunterkommt.
Er hat gesprochen von einem Abgrund von Menschenverachtung.
Absolut.
Und will jetzt missverstanden sein, das ist eine Form von Kommunikation, wo ich sage, das ist keine gelungene Krisenkommunikation.
Hier steht man womöglich entsetzt vor den Effekten der eigenen Selbstpositionierung.
Also hier sollte man vielleicht sagen, man hat einen Fehler gemacht.
Auch das könnte ja vielleicht für den einen und anderen Erzbischof eine Frage kommen.
Aber man sieht, wie unter einem Brennglas, wie sich unter den gegenwärtigen Medien- und Kommunikationsbedingungen Konflikte aufbauen und wie sie einen Überhitzungs- und Festigkeitsgrad erreichen, der sie fast unlösbar erscheinen lässt.
Frau Gebrosius Gersthoff ist ja jetzt diese Woche in die Offensive gegangen.
Du hast das schon angesprochen.
Sie hatte sich bislang zurückgehalten, so wie sich das auch gehört.
Wir haben das auch bisherige Kandidat*innen für dieses Amt eines Richters, einer Richterin des Bundesverfassungsgerichts gehalten.
Die waren aber auch nicht in der Not von Frau Gebrosius Gersthoff.
Nun entscheidet sie sich zunächst eine Stellungnahme zu veröffentlichen, in der sie nochmal sehr genau klar macht, wie denn eigentlich ihre Position in Wahrheit ist.
Und sie hat sich entschieden, zu Markus Lanz in die Sendung zu gehen und hat da gesagt, das fand ich ein sehr interessantes Zitat.
Es geht nicht mehr nur um mich, Herr Lanz.
Es geht auch darum, was passiert, wenn sich solche Kampagnen und es wahr in Teilen eine Kampagne durchsetzen, was das mit uns macht, was das mit dem Land macht, mit unserer Demokratie.
Das muss ich abwägen.
Was macht es?
Denkst du, was passiert, wenn sich solche Kampagnen durchsetzen?
Nun, ich glaube, das ist inzwischen ein ganz gut untersuchter Effekt.
Wir haben Einschüchterung als eine mögliche Folge.
Leute ziehen sich in einem voraus eilenden Opportunismus, in einer Angst, in einem Versuch, sich wegzuducken, zurück, bewerben sich gar nicht für öffentliche Ämter, verlassen ihr eigenes Amt vorzeitig.
Wir sehen das bei manchen Politikerinnen und Politikern, wir sehen das bei Menschen, die öffentlich stark angegriffen werden.
Aus meiner Sicht geht es hier auch um die tiefen Effekte von etwas, was man Vernetzte Gewalt nennen könnte.
Also so in diesem Zusammenspiel der einzelnen Player auf der einen Seite, die Leute, die diese Mailing-Listen starten, auf der anderen Seite einen Bischof, eine AfD, mit die an dieser Spektakelpolarisierung großes Interesse hat und mit Lust zündelt, wieder einzelne publizistische Portale spielen zusammen.
Und am Ende des Tages entsteht auf der Seite derjenigen, um die es geht, Angst, das Bedürfnis nach Rückzug.
Die Frage muss ich mir das eigentlich antun.
Und wenn man mit Menschen spricht, die solche Betroffene sind, Vernetzte Gewalt, dann reden die nicht gerne zumal öffentlich über dies.
Es ist etwas peinliches oder Schambesetztes, aber natürlich hat genau dies Wirkung.
Man wird taktischer in der Art der Kommunikation vorsichtiger, bloß keinen Shitstorm-Gewitter auslösen und man richtet unter Umständen und im Extremfall die eigenen biografischen oder auch Karriereentscheidungen danach aus.
Wie viel Öffentlichkeit - und das gilt insbesondere besonders stark für Frauen - wie viel Öffentlichkeit kann und will ich mir eigentlich zu.
Ich fand sehr beeindruckend, wie sie diesen Fernsehauftritt für sich genutzt hat, wie konsequent sie immer in der Rolle der, wie sie findet, hier angesprochenen Rechtswissenschaftlerin geblieben ist.
Sie ist da nie rausgegangen, hat auch immer wieder darauf gepocht, wenn Markus Lanzi, was persönlich gefragt hat, hat sie gesagt, ich sitze hier in der Rolle der Wissenschaftlerin.
Sie hat dann auch nochmal gesagt, wie sehr ihr Bewusstsein, was die Rolle einer Verfassungsrichterin verlangte und man traut ihr, wie wohl man sie nicht kennt und da ihr nur zuhört, traut ihr sofort zu, dass ihr das spielend gelingt, eine Rolle sauber für sich zu durchdenken und sie dann einzunehmen und konsequent beizubehalten.
Darauf besteht sie dann auch immer wieder in diesem Gespräch, dass sie die abwägende Wissenschaftlerin ist.
Sie weiß aus der Rolle der abwägenden Wissenschaftlerin auf verfassungsrechtliche Dilemmata hin, entschuldigt sich, dass das jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert werden könnte, aber so sei das nun mal.
Sie begreift sich nicht als Aktivistin, weiß das mehrfach und ganz entschieden zurück, dass man ihr das versucht, reinzusingen, dass sie das aber nicht ist und auch präsentiert sie sich nicht, ich habe es gesagt, als Privatperson, die allerdings zu erkennen gibt, dann doch, wie sehr sie unter der Massivität der Anwürfe leidet, wie sehr er umfällt darunter leidet und wie es also doch was mit ihr macht und sie sagt dann, sie würde von der eigenen Kandidatur absehen, wenn sie das Gefühl hätte, dass dem Bundesverfassungsgericht Schaden zukommt oder das Verfassungsgericht darunter zu leiden hat oder aber, wenn es eine fulminante oder veritable Regierungskrise gäbe.
Damit hat sie in meinem Verständnis fast ein kleines bisschen ein Türchen aufgemacht, eine Art von Einladung ausgesprochen, fast weiterzumachen mit dieser Kampagne, weil du hast ja jetzt für all die, die sie erkennbar mit aller Kraft verhindern wollen, wie so ein Zielort benannt, an dem das eintreten könnte, dass Frau Brosius-Gerstorff die verfahrene Situation, die die Union offensichtlich nicht zu lösen, im Stande ist die SPD, sagt bitte, wir halten an unserem Vorschlag fest, hoch anerkannte Frau, was soll mir denn jetzt darunter?
Du schreibst also, wie käme da man daraus, wenn sie zurückziehen würde, wenn das Bundesverfassungsgericht also Schaden nehme oder es eine veritable Regierungskrise gäbe.
Die Unions, manche Unionsleute, so muss man richtigerweise sagen, haben gesagt, sie fänds gar nicht gut, dass Frau Brosius-Gerstorff ins Fernsehen gegangen sei und sich da erklärte und fanden das falsch.
Du hast es eben gut gefunden, nur ich habe mich gefragt, zu wem spricht sie da jetzt eigentlich?
Ich würde sagen, sie spricht in diesem Moment zunächst zu sich selbst, also sie hat sich eine Tür offen gelassen, um wieder Abstand zu nehmen von diesen möglichen Posten und sie sagt, die Kollateralschäden eines Festhaltens an dieser Position sind zu gewaltig und sie spricht natürlich auch in Richtung der jetzigen Koalition, die ein Signal bekommt, unter welchen Bedingungen und mit welcher Begründung vor allem sie dann von dieser möglichen Nominierung wieder Abstand nehmen würde.
In gewissem Sinne halte ich auch das, wenn man das jetzt rein strategisch betrachtet, für außerordentlich klug, denn es ist klar, dass natürlich auch vonseiten der Koalitionäre jetzt ein schlichtes Weg drängen, also man trifft sich im Hinterzimmer und sagt, wir finden eine weitere Kandidatin und auf die haben wir uns bereits verständigt ein schlechtes Weg drängen, nur um einen massiven Preis zu haben wäre und mein Eindruck ist, sie möchte diesen Posten ausfüllen, sie hält sich für geeignet und sie benennt den Preis für die Gegenseite, für den Preis für die Gegenseite und der ist außerordentlich hoch, also nur wenn der Streit in einer völlig unlösbare, absurde Weise, nicht betragbare Art und Weise eskaliert, wäre sie bereit in einer Art Schadens- und Dilemmaabwägung dann aufzugeben.
Ich fand es auch hoch anständig natürlich, weil man daran noch mal sieht, auch einmal mehr, wie sehr sie Wissenschaftlerin ist, wie überzeugt sie vom Verfassungsgericht ist, vom Grundgesetz.
Also mich hat es für sie eingenommen, aber als ich nachdachte über politische Strategien, auch weil ich deine Arbeit ein bisschen kenne, darüber wie man eine Krisenkommunikation wirklich, wirklich klug macht, sodass sie dir nicht selber dann irgendwann noch mehr schadet, da dachte ich, oh, nicht dass ihr das auf die Füße fällt.
Mir ist eine Interview von dir aufgefallen, Bernhard, das hast du im April der Zeit gegeben, als du dein Buch rausgebracht hast.
Da sagst du, wir steuerten auf ein Jahrhundert der Kommunikationskonflikte zu, auch weil ein neuer Autoritarismus an Macht gewinnt.
Erkennst du, dass auch hier, denn Frau Kiprosius-Gerstof hat auch im Gespräch mit Markus Lanz mehr von der Gefahr gesprochen, dass das Bundesverfassungsgericht und die dort arbeitenden Richterinnen und Richter unzulässig politisiert würden, sprich nur noch mit Leuten besetzt, dass diese Posten nur noch mit Leuten besetzt werden dürfen, die einem politisch genehm sind, ganz so wie es Donald Trump in den USA macht, die Peace in Polen gemacht hat, Viktor Orban in Ungarn macht.
Siehst du das auch hier?
Nein, das sehe ich nicht in dieser Schärfe.
Aus meiner Sicht ist es eigentlich schlechte politische Arbeit, Fehl-Einschätzungen für die auch Friedrich Merz an Denke an die missglückte Kanzlerwahl, durch die auch Friedrich Merz immer wieder auffällt, also die Unfähigkeit, reale Stimmungsverhältnisse auch unter den eigenen Abgeordneten einzuschätzen.
Ich habe diese Neumacht des Autoritarismus mit Blick auf die USA formuliert und es gibt ja immer diese Hintergrunddrohung, die Polarisierung in dieser Weise zunehmen, wie wir sie in den USA völlig gespaltene Gesellschaft, entsetzliche Formen von Desinformation, höchsten Regierungsstellen, neue Macht der Big Tech-Unternehmer, die in die gekannter Schamlosigkeit agieren.
Also wird dieses Droh-Szenario auch hierzulande Wirklichkeit, das glaube ich nicht, das ist in mir eine haltlose Übertreibung.
Man muss natürlich auch aus meiner Sicht in der Art und Weise der Diskursbeschreibung aufpassen, dass man nicht selbst apokalyptisch bestimmt ein Beitrag leistet, zu schnell den Untergang zu beschwören.
Inwiefern aber passiert hier was, was dann doch vielleicht die eine oder andere Vergleichbarkeit hergibt, dass du eine gezielt ins Werk gesetzte Kampagne ausgemachte Propaganda zum Schaden einer Frau erlebst, deren politische Haltung denjenigen, die die Kampagne lostreten, erkennbar nicht gefällt und die alles da dransetzen werden, auch im Wege von persönlichen Beleidigung von Morddrohungen.
Frau Bruseus Gersthoff hat erzählt, ihre Mitarbeitenden wagen nicht mehr ins Büro zu gehen, weil sie sich da nicht mehr sicher fühlen, weil es Päckchen gab, die hingeschickt.
So, inwiefern läuft das alles auch bei uns jetzt schon mit den Mitteln, die über digitalisierte Medien einfach mal zur Verfügung stehen und du erlebst, sagen wir, die Anfänge einer Systemzerstörung?
Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Antwort, zwar aus ganz verschiedenen Gründen.
Also zum einen würde ich wirklich auf den Unterschied zwischen den USA und den europäischen bzw.
deutschen Verhältnissen bestehen.
Wir haben eine ganz andere Medienlandschaft, wir haben auch einen Vergleichsweise mit den USA vergleichen, noch eine ganz andere Zeitungslandschaft, der Lokal-Demolismus, der öffentlich-rechtliche Rundfunk besteht.
Und der zweite Grund, warum ich mich schwer tue, ist, dass aus meiner Sicht wir kommunikationsanalytisch betrachtet eigentlich einen ganz unterschiedlichen Weltenleben.
Wir haben eine Welt voller Hass und Hetze und Diffamierung und Wut und Empörungsgetümmel und großer Gereiztheit und lauter überschießenden Energien.
Und diese Welt, die lernen wir jetzt an diesem Beispiel gerade kennen, aber es gibt eben auch eine zweite Welt, manchmal einer moralisierenden Betuligkeit und Hypersensibilität, Triggerwarnung, Safe Space Rhetoric und eine ja vorschnelle Empfindlichkeit.
Und es gibt eine dritte Welt und ich würde sagen, die erleben wir auch in einem Podcastgespräch wie dem jetzigen, sagen der langsam irgendwie verzögerten, idealerweise nach der endlichen Erarterung des authentischen Respekts, so wie heute in Unistätten, Unternehmen, Redaktionen, Schulen, miteinander gesprochen wird.
Das kommt medial kaum vor, aber das ist tatsächlich neu und es ist eine Trift in Richtung des wirklich miteinander Redens.
Also ich würde sagen, es sind echt drei Welten, Hass, Hypersensibilität und authentische Respekt.
Und der dritte Gesichtspunkt, warum ich mich so schwer tue, mit einem akklyptischen oder völlig düsteren Bild, ich bin eigentlich der Auffassung, als jemand in einer Universität arbeitet, diese Arbeit mit seinen Studierenden liebt, dieses Denken an Bildung und diskutieren und die Lust am miteinander sprechen.
Ich bin eigentlich der Auffassung, dass man als jemand, der in so einer Bildungsinstitution arbeitet, bis zum absolut endgültigen Beweis des Gegenteils zu so einem gewissen Aufklärungsoptimismus verpflichtet ist.
Und wenn es, dass man an die Mündigkeit das andern, das Ringen um das bessere Argument glauben muss und wenn es doch schief geht, hat der Aufklärungsoptimist bis zum absolut endgültigen Beweis des Gegenteils immerhin das bessere Leben gehabt.
Ist mir natürlich sagenhaft sympathisch, dass du genau so denkst, wunderbar, ich als Kölnerin, das weißt du, übe mich natürlich auch in ausdauerndem Optimismus.
Hier will ich aber von dir wissen, was macht denn jetzt Frau Brosius-Gerstorff, was machen andere, die solche Kampagnen abbekommen?
Wie stämpft man sich dagegen, gegen die ich nenn sie jetzt mal, Systemverächter und Demokratie zerstörer?
Diejenigen, die also mit Hasse und Hetze arbeiten, gibt es denn da irgendwie eine Art von Waffengleichheit?
Wenn Frau Brosius-Gerstorff, ich bleibe noch kurz bei dem Beispiel, aber ja auch diejenigen, die ihr beispringen, es mit Differenzierung versuchen, mit Präzision, mit wissenschaftlicher Genauigkeit, treffen aber ja auf eine ganz andere Sprache, die davon genau gar nix wissen will.
Bestimmtlich, wir haben das gesehen am Beispiel, wenn man zurückdenkt, 2016 war mit Spritzfallkampf in den USA, Hillary Clinton gegen Donald Trump beim vollkommen asymmetrischen Wahrheitskrieg und jede Form der anständigen Argumentation war gleichsam mit diesem hochlosen, irrlichternden, auch nichtpräsidenten, eine eigene Schäche.
Und ich glaube, man muss unterscheiden.
Auf der individuellen Ebene, und da versuche ich auch meine Universität und andere Institutionen dazu zu bringen, brauchen eigentlich Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und in dieser Weise angegriffen werden, wirklich Fürsorge und Solidarität.
Die brauchen eigentlich drei Telefonnummern.
Die Telefonnummer eines Therapeuten oder Psychologen oder Psychologen, der einem hilft, eines Kommunikationsberater oder Kommunikationsberaterin und eines Juristen oder einer Juristin.
Das scheint mir ganz entscheidend, dass Institutionen sich hier wirklich nicht nur freuen über die öffentliche Wahrnehmung von einzelnen Playern.
Das ist dann im Zweifel der PR-Erfolge für die jeweilige Institution, sondern dass sie eine andere Form von Fürsorge denken und gesellschaftlich betrachtet.
Da bin ich seit langem der Auffassung.
Wir erleben eine laufende Medienrevolution, vergleichbar mit der Erfindung der Schrift, vergleichbar mit der Erfindung des Buchdrucks nun die Vernetzung der Welt.
Und wir haben ein aufstiegtes Populismus, der seinesgleichen sucht.
Und in dieser Gemengelager ist nicht so entscheidend wie eine wertegeleitete Medienbildung, die in der Schule beginnt, ist nicht so entscheidend wie eine Diskursanstrengung, auch der gesellschaftliche Mitte, ein Ringen um die New-Anse, aber auch ein solidarisches Verteidigen eines anderen Argumentationsstils.
Und es braucht in manchem auch als letzte Möglichkeit.
Und so als ein liberal denkender Mensch braucht es auch eine Regulierung, eine behutsame Regulierung sozialer Netzwerke.
Und in diesem Ringen auf der einen Seite Kampf gegen Desinformationen und auf der anderen Seite im Bemühen Kommunikationsfreiheit und Münchkeitsideale nicht zu kassieren oder zu sehr einzuschränken.
Ich will dich noch mal zitieren aus dem Interview, das du derzeit gegeben hast.
Da sagst du, es wäre mehr als naiv zu glauben, dass wir mit ein paar kommunikationspsychologischen Einsichten im Gepäck einem Putin oder Trump entgegentreten können.
Hier geht es um Macht, nicht um Verständigung.
Dann kommt das, was ich schon zitiert habe, dass wir auf ein Jahrhundert der Kommunikationskonflikte zusteuerten.
Und es hört dann auf mit dem sehr guten Satz, den ich jetzt mal als die Handlungsanweisung nehme, um sich gegen manches zu stemmen, was da passiert, auch wenn ich mir das nicht einfach machen will, ist ja klar.
Da sagst du, und hier müssen selbst die größten Liebhaber des Dialogs anerkennen.
Manchmal muss man Quatsch, einfach Quatsch und Hass, einfach Hass nennen, Punkt.
Das wäre dann eine Art von Waffengleichheit, glaube ich, dass man sich gar nicht auf diese Ebene begibt.
Was aber leichter gesagt als getan ist, denn übertragen nochmal auf die Situation von Frau Brosius-Gerstorff und auf das, worum es da geht, nämlich die Besetzung eines Postens am Bundesverfassungsgericht lässt sich das natürlich nicht so easy übertragen, dass die jetzt mal sagt, höh, Quatsch ist Quatsch und Hass ist Hass, damit kommt sie ja auch nicht durch, sondern sie muss sich jetzt aufrüsten, wie du es beschrieben hast.
Sie hat im Interview mit Markus Lanz erzählt, dass sie sofort eine befreundete Anwaltskanzlei beauftragt hat oder eine Anwaltskanzlei, die sie kennt, denen vermeintlich im Plagiatsvorwürfen nachzugehen, die er sich ja auch noch zu erstaunen hat.
Erdulden hatte, wenn gleich der sogenannte Plagiatsjäger selbst schon eine Stunde später sagte, nee, also da sei jetzt falsch verstanden worden, das fiel also vollständig in sich zusammen, das hat sie prüfen lassen und dabei ist es auch in sich zusammen gefallen.
Er versucht ja, Dinge zu tun, aber ist wirklich, wie ich finde, in einer Art von Not, was nicht sein müsste, weil diese anerkannte Frau ist, die echt etwas geleistet hat und die wahrscheinlich auch eine gute Verfassungsrichterin wäre.
Wie geht Gutes zu hören, Bernhard?
Darüber will ich mit dir sprechen und ich habe gelesen von dir den Satz, wir hören, was wir fühlen und wir fühlen, was wir selbst erlebt und erfahren haben.
Etwas wirklich zu hören, hieße etwas in veränderter Form erneut zu hören und dann kommt deine Unterscheidung vom Ich-Ohr und Du-Ohr und dabei bildet letztes, also das Du-Ohr, die entscheidende Komponente für wirklich echtes und Gutes zu hören, echtes zu hören, schreibst, entstehe wenn man sich fragt, in welcher Welt ist das, was der andere sagt, plausibel, sinnvoll und wahr, das ist eben auch schon zitiert, man müsse genauer beobachten anstatt vorschnell zu urteilen oder zu verallgemeinern, kannst du das?
Nein, ich würde sagen, ich bin eigentlich ein relativ schlechter Zuhörer, man beschäftigt sich ja auch immer mit dem, was man sogar nicht so wahnsinnig gut kann, Sprungbrett zu hören, also man sagt, oh ja, jetzt will ich auch nochmal, da fällt mir Folgendes zu ein oder geht es gesamt, wir Menschen sind bestätigungssüchtige Wesen, wir leben im Kokon, unsere eigenen Urteile und Vorurteile geleitet von unseren Sehnsichten und Wünschen, weniger von dem, was uns mal den schöner, mal den hässlicher oder auch bedrohlicher Formen mit gegentritt und wir erleben natürlich, damit bin ich wieder bei meinem Thema als Medienwissenschaftler etwas, was man vielleicht eine Programmierung der Ungeduld nennen könnte, rein durch die sozialen Netzwerke, durch das auf dem Smartphone, durch das auf dem Tisch liegende Smartphone, das immer wieder aufblind und ablenkung produziert, also wir wissen sehr genau aus den entsprechenden Studien, dass unter diesen Bedingungen der Dauerablenkung Themen von einer bestimmten Tiefe, von einer extenziellen Bedeutung gar nicht so leicht zu Sprache kommen.
Also das ist das, was mich am Zuhören fasziniert, wenn man es studiert, dann sieht man die Natur des Menschen und diese Natur des Menschen ist aus meiner Sicht gar nicht so furchtbar offen, sondern auf Bestätigung aus, auf Harmonie aus, nicht auf die Auseinandersetzung mit dem Fremden und Einartigen hinorientiert und man sieht auch, wie sich die Medien- und Kommunikationsverhältnisse verändern zu lasten des wirklichen Zuhörens, der konzentrierten Zuwendungen zum anderen und man kann besser verstehen, unter welchen Bedingungen dann doch manchmal zuhörbar jähren und durchbrochen werden können und in Extremfall weltweite Aufmerksamkeit entsteht.
Was hast du beim Schreiben über das Zuhören nun gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
Ich würde sagen, ich habe gelernt, wenn ich das in einem Satz sagen soll...
Musst du nicht, wir haben ja Zeit.
Nein, also für mich selbst, auf eine Formel bringen sollte, dann würde ich sagen, Zuhören braucht Zeit, eigentlich ist der Kontext die Botschaft.
Wenn man den Kontext studiert, die Zusammenhänge ausleuchtet, um die Nürnse regnt, dann kann etwas Richtiges gesagt, dann könnte an etwas auf richtige Weise verstanden werden.
Mich hat so eine kleine Geschichte außerordentlich beeindruckt, von dem du hast mich ja ermutigt, jetzt länger zu antworten.
Wenn ich jetzt gleich bereue, pass auf Bernda.
Also jetzt ist es verloren, aber ganz einfach mir zu sagen, ich habe so eine kleine Parabel von Zürich Kirkegaard, den dänischen Philosophen ungeheuer beeindruckt, von dem klar on folgende Situation, da ist das so ein Zirkuszelt am Rande eines irgendwie staubtrockenden Felses in der Nähe eines Dorfes und im Zelt, da haben sich schon für die Vorstellung vorbereitet, entsteht ein Feuer und der Clown wird schon voll verkleidet, in lustigen latschen Grelgeschwingt ins Dorf geschickt, um jetzt Hilfe zu holen, weil die Leute im Zirkus diesem Feuer nicht mehr her werden und erreicht den Marktplatz und wirft sich da auf diesen Marktplatz und sagt, kommt alle zum Zirkuszelt, um Himmelswerden, es brennt, es brennt, und die Umstehenden denken, was für ein gigantischer Scherz, was für ein raffinierter Berber und Marketingtrick der Clown will uns zum Zirkus locken und der macht das mit diesem Feuertrick und dann kommt es, das Feuer und brennt alles wieder, also es sind Images, vorgefasste Wahrnehmungen, Stereotypisierungen, Vorurteile, die unser Zuhören leiten, der bestallt, dass wir bei dieser Geschichte von Zürich Kirkegaard eigentlich sofort überzeugen sind, ja der Clown, der redet nur Quatsch, der macht nur Späße, der will uns mit einem Trick zum Zirkus locken und in Wahrheit ist da gar kein Feuer und diese kleine Parabel, die hat nicht ungeheuer beeindruckt, denn um das Zuhören zu verstehen, muss man die Zuhörbarrieren ausleuchten, all die Hindernisse, die großen und kleinen Blockaden und man muss sich versuchen, idealerweise zu einem Zuhörer oder einer Zuhörer in der Zukunft zu werden, von den eigenen, sofort urteilen, ein Moment lang zu lösen, in gewissem Sinne dem Clown zu glauben, daran besteht die merkwürdige Aufforderung, die sozusagen versuchen mit diesem Buch zu begründen.
Nun hast du eben gesagt und ich glaubst dir nicht, dass du nicht gut zuhören kannst, denn dein Buch, wo auch die Geschichte von dem Clown, der darum fleht, dass man ihm glaubt, vielleicht zu Beginn vorkommt und tatsächlich eine sehr, sehr gute Parabel dafür ist, wie einen vorurteilen, schnelle Urteile davon abhalten, tatsächlich zuzuhören.
Also dein Buch lebt ja davon, dass du Menschen über Jahre immer wieder getroffen hast, sie gefragt und ihnen klar zugehört hast, wie zum Beispiel Jerry Brown, den langjährigen Gouverneur von Kalifornien, der die Stille sucht und an der Klimakrise leidet, der stets Mönch sein und US-Präsident werden wollte und der dir den schlechtesten Kaffee ever serviert, irgendwie übrig geblieben vom Vortag oder noch davor, macht er noch mal warm und du schüttest ihn ganz schnell runter.
Also du hast dich auch richtig reingeworfen in die Recherche, ohne Rücksicht, auch Verluste.
Du triffst die Künstlerin Jenny O'Dell, die Tag für Tag im Rosengarten sitzt und übers Nichtstuhn nachsind, du triffst den Unternehmer Misha Katsurin aus Kiew, der mit seinem in Russland lebenden Vater über den Krieg gegen die Ukraine sprechen will, Papa glaubt mehr, fleht er und macht daraus ein Projekt, das euch wahrscheinlich auch schon mal begegnet ist, das weltweit Aufmerksamkeit zieht, er will mit seinem Vater sprechen, er will, dass der Vater ihm glaubt, aber er scheitert daran, weil der Vater auf die Russisch Propaganda hört, hat allein von der sogenannten Spezialoperation gehört und glaubt Misha nicht, dass der den Krieg tatsächlich erlebt, was er aber tut und dass er darunter leidet, was er auch tut.
Den allen hast du doch immer und immer wieder zugehört und sie haben dir immer weiter erzählt, wenn du so schlecht machtest, hätten die dich doch weggeschickt, meinst du nicht?
Ja, es ist natürlich eine völlig künstliche und auch vielleicht leicht absurde Situation.
Ich habe die persönlichen Ausgangspunkte für dieses Buch und auch die eigene Irritation über das nicht wirklich zuhören geschildert, am Beispiel der Odenwaldschulung, das hat mich wirklich beschäftigt und im Grunde genommen auch betrübt, aber sich so viel Zeit zu nehmen, drei Jahre lang hinweg in ein Rosengarten in Oakland zu fahren und einer Schriftstellerin zuzuhören, die immer wieder ein neues Buch nach draußen bringt, aus diesem Rosengarten heraus oder vier Jahre zu Jerry Brown auf seine Farm zu pilgern oder Misha Kaltzerin, diesen ukrainischen Unternehmer, den du erwähnt hast, über so viele Jahre zu begleiten oder manche der Missbrauchsbetroffenen über ein Jahrzehnt hinweg immer wieder zu sprechen.
Das ist natürlich einfach die Herstellung einer Situation, die man sich nur als hoffnungslos privilegierter Wissenschaftler leisten kann und erst mal nicht auf den Output schaut, wo man sagt, das Buch muss irgendwie sich selbst verkörpert und man muss eigentlich das machen, was man erreichen will.
Insofern für mich war es zum Beispiel ganz wichtig, mal ein ganz bananes Beispiel, viele dieser Gespräche aufzunehmen und sie dann abzutippen.
Durch dieses Wiederhören, durch das Transkribieren, durch das nochmal Lesen, das Aufgeschriebenen entdeckt man dann New-Ansen.
Also ich habe mich eher gezwungen aus meinem, jetzt muss das Buch endlich mal fertig werden, was arbeitest du schon vier oder fünf oder sechs oder sieben Jahre daran, Modus herauszukatapultieren und durch die Art des Arbeitens mehr unendlich viel Zeit zu nehmen, aber ich gebe zu, das ist eine leicht künstliche Situation.
Also ich bestehe darauf, ich bin in Wahrheit kein wirklich guter Zuhörer, aber es gibt Techniken, die einen zwingen und das Transkribieren und Wiederlesen, das ist eine Technik, um so eine Verzögerung zu etablieren, es gibt Techniken, um sich ein bisschen stärker der Welt zu eröffnen.
Aber davon hat er dann deinen Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin, unmittelbar noch nicht.
Du reißt da ab, du hörst das ab, was du aufgenommen hast, du beschreibst das auch in einer Stelle, dass du mit Jerry Brown da übers Land fährst und der Wagen rattert so, dass du dir Sorgen machst, ob nachher auf dem Smartphone und auf der Aufnahme überhaupt irgendwas drauf sein wird.
So, das kann ich mir sofort vorstellen als Technik, dass man dann, wenn man es auch abgeschrieben vor sich sieht, auch Zwischentöne, auch Wörter noch mal anders wahrnimmt, die einem vor vielleicht durch die Ablenkung der Umgebung und was was ich durchgegangen sind.
Davon hat aber ja deine Gesprächspartnerin, deine Gesprächsparte in dem Moment nichts.
Wie gehen denn da die Techniken jenseits der Techniken, die ich zum Beispiel in Interviews anwende, dass man das Gesagte demjenige noch mal vorlegt, dass man sehr genau darauf aufpasst, ob ihm der Antwort sowas wie Angebote sind, wo man nachfragen sollte oder so.
Also welche Techniken hast du dann übers Schreiben für dich entwickelt, vielleicht dann doch, bei denen du sagen könntest, das kann man lernen und dein Untertitel, die Kunst sich der Welt zu öffnen, zählt nicht auf eine reine Kunst, sondern auch auf ein handwerklichen Teil dieser Kunst.
Sprich, man kann sich das erarbeiten.
Ja, der Tat, also ich würde sagen, Kunst in diesem Sinne meint eigentlich eine Kunst des herausfindens, passend zur eigenen Person, passend zur jeweiligen Situation, in der man sich befindet.
Also sich Zeit nehmen, Abschied von der Sofortverurteilung, etwas trainieren, was den Buddhisten, den Anfänger Geist nennen, aber sich auch dem Echo der anderen wieder aussetzen.
In der Tat, es könnte ja so sein, man kommt da wie so ein Gefühlsvampier, hört Menschen zu, knackt sie in gewissem Sinne, sie erzählen einem die privatesten Erfahrungen und dann verlässt man sie wieder.
Beispiel eine Schulleiterin der Otenwaldschule, die in einem sehr entscheidenden Moment die Tür geöffnet hat und den Betroffenen zugehört hat, in diesem Buch von ihrer eigenen Missbrauchsgeschichte berichtet.
Da habe ich sehr lange darüber nachgedacht, wie kann ich diese Geschichte auf eine ausreichend respektvolle, behuntsame Art und Weise erzählen, endlose Recherche, der Versuch Kontexte wirklich zu verstehen, der ungeheure Druck, unter dem diese Frau aus meiner Sicht auf eine eigentlich heldenhafte Art und Weise, selbstlose Art und Weise agiert hat, weil sie die Erfahrungsberichte, die sie zuhörerbe, wieder traumatisiert haben.
Das alles sichtbar zu machen.
Aber dann zum Beispiel ganz simple auch mal so ein Kapitel vorlesen, dem anderen vorlesen und sagen, was habe ich verstanden, was habe ich noch nicht begriffen, nicht in der Bereitschaft, das wäre ganz unprofessionell in gewissem Sinne unjournalistisch zu sagen, der andere kann sich jetzt in den Text verwirklichen, den man selbst produziert hat, aber das ist Technik, die ich von einem kandiosen Reporter, Bastian Werbner, mal gelernt habe, der sagt, bei das Porträt schreiben hat immer was leicht unmoralisches, man kommt, man bricht jemand auf, der zählt einen Dinger, der vielleicht niemand anderes erzählt und dann verschwindet man und liefert eine Deutung und dann ist der Kommunikationsprozess abgehackt.
Aber hier zu sagen, ja, ich übersetze dieses Kapitel und ich schicke es wie Schakazurin in die Ukraine, jemand, der in Kiew bombaliert wird, der versucht, seinen Vater verzweifelte Weise zu erreichen, der versucht, ein Dialogprojekt unter den Bedingungen des Krieges, ein Projekt des Aneinanderzuhörens und miteinander Redens aufzusetzen, zu Beginn des Krieges, ich schicke ihm dieses Kapitel und wir sprechen dann noch mal und ich ändere es nicht darauf hin, dass ich ihn besser oder anders beschreibe oder Kritik rauslasse, aber ich mache, ich setze mich selbst aus und diese sich selbst berührbar machen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das Menschen, das merken, wir alle sind Expertin und Experten bei der Entlarvung von Heuchelei, kommt da jemand, der nur irgendwie eine gute Zeile haben will oder kommt da jemand, der wirklich ein Gespräch führen möchte, der sich tatsächlich aussetzt und so entsteht dann etwas anderes oder Dritters, also jemand, der sich berührbar macht, frei nach diesem dialogischen Credo von Nietzsche oder Hannah Arendt, die Wahrheit beginnt zu zweit.
Ich verlasse dann auch die Ruhebank einer festen Gewissheit, wenn ich wirklich zuhöre und in diesem Sinne zuhören, als ein Bild für Offenheit oder etwas, was Christina Thürmerrohr, einmal eine Sozialwissenschaftlerin und Musikerin, einmal innere Gastfreundschaft genannt hat, das finde ich ein wunderbares Bild, also man lässt den anderen in seiner Andersartigkeit wirklich zu, heißt ihn erst mal willkommen, das heißt nicht, dass man nicht auch mal zu einer Verurteilung voranschreitet und sagt, nein, ich habe es verstanden, ich möchte nicht mehr zuhören und den Kommunikationsabbruch bewerkstelligt, aber die Frage ist wann.
Und aus meiner Sicht teilen wir, wenn ich jetzt mal einen setzlichen Pauschal werden darf, zu viel, zu schnell, zu unmittelbar, zu direkt.
Das spricht ja jetzt aus dem, was du sagst, was ein Faktor dafür war, dass Gespräche dir gelungen waren, du sie vielleicht deinen Gesprächspartner*innen auch nochmal vorgelegt hast und die so nehme ich mal jetzt an, am Schluss und gesagt, ja, da fühle ich mich richtig verstanden, das kannst du so veröffentlichen, Bernhard, alles in Ordnung.
So dann war doch einer der Faktoren, die dir wirklich gewolfen haben, Zeit, dass du immer wieder gekommen bist, auch über Jahre hinweg.
Ich will auch nicht pauschalieren und sowieso sind wir jetzt hier ja nicht im Achtsamenkeitsworkshop oder sowas, aber müssen wir, also du kannst dich immer auf viel Zeit für jedes Gespräch haben, bei dem du gut zugehört hast, dennoch glaube ich, dass wir sowas wie so ein, wenn es das gibt, Geduldsmuskel trainieren müssten, um uns gegen all das zu stemmen, was du schon angesprochen hast, worauf ich jetzt gleich kommen will, was an Stress, an Gleichzeitigkeit, an Ablenkungen auf uns einprasselt und uns genau nicht geduldig sein lässt und auch nicht geduldig zuhören lässt.
Ja, in der Tat, ich würde sagen, dass man so ein Geduldsmuskel braucht, ich finde das eine wunderbare Formulierung, weil es wäre ja so leicht jetzt in so ein Predigaton zu verfallen.
Ja, der Anfängergeist aus dem Senbudismus, der ist so leer, das ist toll.
Aber das heißt ja auch, also auf dem Weg zu einer anderen Kommunikationskultur um eine andere Art des Sprechensrennen eben nicht zu predigen, ihr müsst jetzt alle euch unendlich viel Zeit nehmen und wer sich keine Zeit nimmt, ist schon auf dem falschen Pfad, das wäre ja ganz unrealistisch, aber den Geduldsmuskel trainieren, das ist eine Formulierung, die ich mir merken würde, die hat so was, ja, wir müssen ja, oder aus meiner Sicht sollte man, ich würde versuchen, in den Ringen um eine andere Kommunikation frische, neue Wörter zu finden, abseits so einer moralisierenden, abseits so einer brutulichen Ansprache und Geduldsmuskel ist echt ein gutes Wort.
Okay, danke, das freut mich aus deinem Munde, denn du kannst wirklich, dafür ist auch das Buch ein Beweis, wirklich schön schreiben, sehr, sehr schön formulieren und findest andauernd und immer fort Formulierungen, bei denen ich zum Teil glucksend lachte beim Les, weil ich das so mochte, also danke dafür, Geduldsmuskel kannst du gerne, aber gerne auch mit Verweis auf mich.
Ja, mit einer Flussung, und wir sollten jetzt nicht so nennen, die Leute, die Einschaltquote sehe ich jetzt in freiem Fall, wir sind nicht so nett zur Lande.
Ja, lass uns weitergehen zu dem Kapitel, das du die Utopien des Silikernwelle genannt hast, beschreibst darin noch mal die Anfänge, die von sowas wie Basisdemokratie handelten und davon, dass man ein unfassbarer Werkzeuge zu echter großartiger, weltumspannender Kommunikation entwickeln wollte, inzwischen, aber in einem Istzustand angekommen, ist der nicht nur oder eventuell auch gar nicht mehr richtig gut tut, ich liebe manche Instrumente, keine Frage, wir nutzen sie alle, wir wissen aber auch alle darum, wie sehr sie uns bedrängen, wie sehr sie unsere Aufmerksamkeitsspannen verkürzt haben, ich ertappe mich dabei, wenn ich eine echte Zeitung sehe, dass ich da drüber wische und denke, ich könnte damit umblättern und bin also auch schon irgendwie komplett deformiert durch das, wie ich lese, nämlich über e-Paper und natürlich dann sehr viel bei Social Media, bei X und bei Blue Sky und so weiter und so fort, Instagram, halte ich gar nicht aus, weil mir das zu viel Zeit frisst, also bin ich da nicht unterwegs, dagegen kann ich mich nicht richtig anstemmen, so was hat das für politische Konsequenzen, wenn sich Typen wie Elon Musk und die anderen Tech Bros, die sich ganze Plattformen kaufen können oder sie schon haben, die an den Algorithmen schrauben, um die eigenen Posts präsentert zu machen, die sich insgesamt immer ausgefeilterer und ja hochpolitisch gedachter Manipolationstechniken bedienen, was hat das für Konsequenzen und können wir denen noch mit all dem, was wir da gerade angeschaut hatten, begegnen, indem wir sagen, bitte ich höre geduldig zu und ich mache mich auf den Weg zum Kern des Ganzen.
Natürlich, das kann man versuchen und ich glaube, das Zuhören ist so eine Ursehensucht des Menschen, eine Sehensucht nach dem Verstand und akzeptiert werden, dass diese Ursehensucht quasi unzerstörbar ist, selbst durch eine Figur wie Musk oder Zuckerberg oder Jeff Bezos und durch die totale Vermachtung von Öffentlichkeit im Gestalt dieser Plattform.
Also diese Ursehensucht wird immer bleiben und wenn man mal die schönsten Erlebnisse des eigenen Lebens an im Bewusstsein vorübergleiten lässt, dann würde ich sagen, sie haben in der einen oder anderen Formen, ohne dass ich jetzt deine Hörerin oder Hörer genauer kenne, mit dem Zuhören zu tun, mit dem gehört werden, mit dem Verstand werden.
Also diese Ursehensucht, das ist meiner Sicht unzerstörbar, aber das gesagt, in der Tat, das ist aus meiner Sicht eine total gefährliche Konsellation, die wahnsinnig politische Folgen hat.
Das ist ja eigentlich eine Vermischung von jetzt in gestaltet Big Tech-Unternehmer von politischer Macht, von digitaler Macht und von ökonomischer Macht.
Man kann das gut fest machen.
Eine Figur wie Elon Musk vor bis vor wenigen Wochen noch einer der zentralen Präsidentenflüsterer, jemand, der sich leisten kann, für 44 Milliarden Twitter-Ex zu kaufen, der sich leisten kann, 3 Millionen Dollar am Tag damit Verlust zu machen, der mehr als 200 Millionen Follower zwangsweise mit seinen Desinformationspostings beglückt, er zwingt seine Ingenieure nachweislich, seine Desinformationspostings bevorzugt, in die Timeline seiner Plattformgemeinschaft hineinzudrücken.
Also das sind Machtasymetrien, wie wir sie noch nie hatten.
Und die haben Folgen, also Folgen für das ansehende Journalismus, Folgen für unser Kommunikationsklima im Allgemeinen.
Aber wenn wir von dort aus nochmal, du hast dieses Silikon-Valleyreisen erwähnt, versuchen auf so eine Anderswelt zu blicken.
Also ich habe mich lange rumgetrieben im Hafen von Sausalito.
Das ist so faszinierend, müsste man eigentlich mal so ein Netflix-Film machen, da sind superreiche Internet-Unternehmer, verpeilte Computer hippies, Genies und Outdrops aller Art.
Und hier im Hafen von Sausalito ist in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, eine der ersten Online-Gemeinschaften der Welt entstanden, ungeheuer, einflussreich, vorvielend für ganz viele andere Online-Gemeinschaften.
Nur das Interessante war für mich und deswegen habe ich jahrelang jetzt, diese Gemeinschaft existiert auch noch, die Leute befragt und erforscht.
Man hat da anders zuhört, man hat anders gestritten, sich respektvoller auseinandergesetzt.
Es gab einen anderen Diskurs und woran lag das?
Ganz einfach, es gab keine Anonymität.
Es gab eine andere Form der Finanzierung, kleine Abogebühren, überhaupt keine Werbung.
Es gab jede Menge Meinungsfreiheit, aber eine massive Moderation mit jemandem, der aus dem Ruder lief und einen Shit-Stop man nannte das damals, ein Flame-War, verbreitete, mit dem hat man unter Umständen drei, vier Stunden telefoniert als Moderator und den wieder auf Kurs gebracht.
Und es gab sozusagen auch eine relative Kleinheit.
Die sozialen Netzwerke der Gegenwart sind vollkommen unüberschaubar und man kann eben Kommunikation nicht skalieren, also man kann es skalieren, aber dann zerstört man sie und dann treiffen permanent in diesem Welt-Innenraum der vernetzten Kommunikation, deswegen spreche von einem Jahrhundert der Kommunikationskonflikte Perspektiven aller Art, große und kleine Ideologien aufeinander und wir sehen zu viel zu schnell, so unmittelbar zu direkt, auf einem einzigen Kommunikationskanal.
Und das Interessante ist für mich, deswegen ich versuche immer positive Bilder noch aufzubieten in diesen düsteren Zeiten, dass diese Computerhippen ist der ersten Stunde, Mitte der 80er Jahre Prinzipien und Vorgehensweisen entdeckt haben, die man eigentlich wieder ausgraben könnte.
Man könnte zurückkehren in die Frühgeschichte des Netzes und das versuche ich an dieser Stelle in diesem Kapitel dieses Buchs und sagen, in welchem Moment sind wir eigentlich falsch abgebogen.
Wir sind falsch abgebogen, indem wir unser Diskursplattform nach den Prinzipien der Werbeindustrie und orientiert an dem Reichtum ganz weniger neu organisieren.
Das ist der Urfehler.
- Aber du kriegst es ja nicht zurückgebogen.
Du kannst jetzt nicht sagen, komm, lass mal nur, keine Ahnung, 0,1% von euch machen weiter.
Dafür haben wir 50.000 Moderatoren, die vier Stunden telefonieren.
Du kriegst es ja nicht wieder eingefangen, oder?
- Na, ich denke schon, dass die Regulierungsanstrengung der EU, man muss sehen, inwieweit jetzt so etwas wie der Digital Service Act tatsächlich durchsetzbar ist, dass die Regulierungsanstrengungen in die richtige Richtung gehen, dass jetzt in der neuen Entfremdung zwischen Europa und den USA kann es sein, dass all dies nicht durchsetzbar ist.
Aber hier, diese Information mit einer anderen Entschiedenheit zu bekämpfen, geht in die richtige Richtung und natürlich könnte man theoretisch gesprochen.
Plattformunternehmer zwingen ganz anderer Weise, Diskurse zu moderieren, falsche Nachrichten mit einer anderen Direktheit, Unmittelbarkeit und Geschwindigkeit zu löschen.
Natürlich könnte man auch in einer ganz anderen Intensität in Medienbildung investieren.
Ich glaube, in gewissem Sinne, und das ist so eine Bildungsvision, die ich seit langem versuche, in die Öffentlichkeit zu tragen.
Früher in einer anderen Zeit war Journalismus vor allem ein Beruf, aber eigentlich ist Journalismus, ich nenne es die redaktionelle Gesellschaft als Bildungsutopie, auch so etwas wie eine großartige Bildungsvision, Faktor und Fiktion unterscheiden, die andere Seite hören, Quellen studieren, eine Ereignis nicht größer machen, als es ist, überhaupt verschiedene Quellen haben, sich an Relevanz und Proportionalität orientieren.
Das sind eigentlich maxim das guten Journalismus, die aus meiner Sicht heute in dieser redaktionellen Gesellschaft und Zukunft, die eigentlich heute zu einem Element der Allgemeinbildung werden müssten.
Also es bräuchte Bildung, es bräuchte auch eine gesellschaftliche Mitte, die sich mit einer anderen Heftigkeit und Intensität um eine andere Kommunikationskultur bemüht.
Viele der gemäßigten schweigen viel zu laut und es braucht diese behutsame Regulierungsanstrengung.
Ich denke nicht, dass die Dinge verloren sind und man kann das eine oder andere schöne Beispiel, die Computer hippies im Hafen von Sausalito, der heller kalifornischer Sonne, habe ich erwähnt, man kann das eine oder andere schöne Beispiel auch wieder entdecken in der Früh- und Urgeschichte.
Das Netz ist ein eigentliches Netz, ja bei allem Schrecken, das Moment, ein wunderbares Medium.
Mark Zuckerberg, das wissen wir, einer der Tech Bros hat sich anders entschieden, macht keinen Fakten, checkt mir will er nicht mehr, das heißt, da siehst du die Entwicklung in die aus deiner Sicht meiner auch falsche Richtung.
Was ich mich gefragt habe in der Vorbereitung ist, wir wissen doch so viel.
Wir wissen spätestens seit Trump 1, aber auch seit dem Brexit eine Menge über Desinformationskampagnen, über Fake News, über Troll, über Bords, über Fake Profile, auch immer mehr über KI generierte Fälschungen, all das gibt es dann nicht langsam, doch, das beobachtet wahrscheinlich auch jeder und jede unserer Hörer*innen an sich selbst, da gibt es doch auch so was wie ein Lerneffekt oder einen souveräneren Umgang mit diesen Medien oder Gaukel, ich mir das zum Beispiel vordenke, ich bin so ganz nase weiß und sauschlau unterwegs und in Wahrheit bin ich schon auf das nächste Ding angefallen.
Ja, ich denke, das hat, dass die Macht der Desinformation gerade jetzt in Zukunft dieser laufenden KI-Revolution immer größer wird.
Wir haben die Fakes, der Audiobeweis, der Videobeweis, ist angreifbar, wir haben die scheinbar die Verhaftung von Donald Trump gesehen, den immer liegenden Tabs in der Gucci Down, weißem Gucci Down-Jacke, wir haben angeblich Zelensky gesehen, wie er vermeintlich zu Kriegsbeginn für seine Soldaten hintritt und die Kapitulation erklärt, deep fake.
Also ich bin an der Stelle prinzipiell aufklärungsoptimistisch, dazu habe ich mich gleich so verpflichtet, sonst vermittle ich mich in endlose Widersprüche, aber doch einigermaßen pessimistisch, was die jetzige Phase angeht, denn wir sehen, dass jetzt das Wahrheitsempfinden ganzer Gesellschaften nochmal betäubt wird.
Auf der einen Seite gibt es im Zuge dieser laufenden KI-Revolution jetzt jede Menge sofort herstellbare Scheingegessheiten, also deep fake Videos, fake photos, scheinbare Audiobeweise.
Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, und das halte ich für mindestens ebenso gefährlich, nicht nur jede Menge Scheingewissheiten, die man beweisen kann durch irgendwelche Dokumente, die dann nicht authentisch sind, sondern es gibt auch so etwas wie ein fake Gefühl, dass sich jeder Gesellschaft ausbreitet nach meinem Eindruck.
Also Menschen halten nicht nur vor schnell etwas für real, sondern sie halten unter Umständen auch etwas vor schnell für gefälscht.
Auch das kann doch nicht stimmen, da hat doch jemand womöglich einfach eine Software benutzt oder irgendeine moderne Medientechnologie und das sind Sprechende aufzuhübschen.
Also diese Gleichzeitigkeit von zu viel Scheingewissheit und Fake-Gefühl, die es geeignet ist, Wahnsinnfinden von gesetzten Gesellschaften zu betäuben.
Und aus meiner Sicht, wenn es gut läuft, erleben wir eine Übergangsphase der Medienevolution, eine vernetzte Pubertät-Digitaler-Gesellschaften.
Und an dieser Stelle kommt es jetzt wirklich an auf Regulierungen, auf Discourse und vor allem auf Bildung und das Ringeln um eine enormativ entschiedenen Medienbildung.
Bei der politischen Situation hier dann ja entscheidend in den USA, wie sehr aber vertraust du darauf, dass jemand wie Donald Trump und seine Merkale heute, dass die dieses gigantische Instrument aus der Hand geben würden und regulieren ließe, darauf habe ich gar keine Hoffnung.
Nein, das scheint mir auch, also insofern kommt jetzt das ganze Entscheidende auf die Einigkeit Europas an.
Und das ist ja auch versichtlich.
Gini Wenz hat bei der 16.
Münchner Sicherheitskonferenz im Grunde genommen auf offener Bühne gedroht.
Wenn ihr Elon Musk mit Regulierungen überzieht, dann kippt der Naturschutz.
Also ich verkündete es jetzt etwas, aber in diese Richtung ging es.
Das nennt man auf der Straße Erpressung.
Also da hatte ich keine besondere Hoffnung.
Aber insofern kommt jetzt umso mehr alles an auf eine geordnete und entschieden europäische Linie bei allen geopolitischen Verwerfungen, bei aller Entfremdlung zwischen den USA und der Notwendigkeit natürlich auch mit einer Figur wie Trump nun umzugehen.
Wie geht Gutes zu hören?
Darüber sprechen wir, Bernhard, und sind jetzt, glaube ich, an einem entscheidenden Punkt angekommen, bei dem ich denke, wir können fast zum Anfang zurückkehren, insofern als dass ich das genau auch in dem Fall, der kein Fall ist, im Sinne von runterfallen, von Frau Borosius Gerstdorf sehen, nämlich dass es an all diesen Punkten, wo demokrativer Echter einer Institution schaden wollen, darauf ankommt, dass man sich ihnen mit Entschiedenheit entgegensetzt und entgegenstimmt, um zu sagen, das lassen wir nicht zu.
Gutes zu hören, wir haben sie identifiziert, verlangt Zeit, verlangt Geduld, verlangt die Bereitschaft, sich in das Denken, die Situation des anderen wirklich hinein zu versetzen.
Das hat nichts Autoritäres, ganz im Gegenteil.
Das ist davon getragen, dass man sich zuwendet.
Davon lebt die Demokratie, das ist eine ihrer Voraussetzungen, dass sie die anderen respektiert, sonst würde man nicht auf ein Mehrheitsentscheid hören.
Wenn wir das alles zusammenführen, dann ist das doch jetzt ein entscheidender Punkt, an dem Gutes zu hören, worüber du geschrieben hast, in Wahrheit meint, sich aufbäumen gegen das, was sich da international, aber in Ansätzen auch längst in Deutschland und Europa tut und was unsere Art des Zusammenlebens kaputt machen will, oder?
Ja, ich denke schon, wir leben in einem definierenden Moment der Zeitgeschichte.
Es hat die Rede von der Zeitenwende, Olaf Scholz, dies real, den Angriff auf die Ukraine, es gibt jetzt, erkenn mal, mich fast wie so eine Art zweite Zeitenwende, diesen Versuch von Donald Trump seiner Art populistischer Internationale zu schmieden und auf diese Weise die Weltgeschichte zu beeinflussen und zu prägen.
Und wir erleben eine mit unterbedrohlich wirkende, bei allen Gegenbeispielen, über die wir auch gesprochen haben, bedrohlich wirkende Überhitzung des Kommunikationsklimas.
Und da ist man gefordert mit den eigenen, in meinem Fall mit den eigenen kleinen oder Möglichkeiten ab und zu so ein Buch zu formulieren oder zu schreiben und dann wie so eine Flaschenposte ins Meer zu werfen und zu hoffen, dass ein paar Leute das interessant finden und diese Flaschenpost lesen.
Also ich glaube, man darf auch nicht in so eine Art Kontrollwahn verfallen und zu der Auffassung gelangen.
Man könne sich jetzt sozusagen gegen diesen populistischen Autoritarismus mehr damit im Alleingang stemmen.
Aber das Gespräch, das miteinander reden, auch die eigene Ratlosigkeit jetzt zum Thema zu machen, das nicht weiterwissen, die strategische Unruhe der gesellschaftlichen Mitte zu debattieren, dafür überhaupt wieder Räume zu schaffen, im Angesichts eines, aus meiner Sicht eben doch politischen Wallbacks, das schien mir so etwas wie das Geburtestunde, ja.
Du plädierst für eine Tugend und die nennst du "Respektvolle Konfrontation".
So sollte man zuhören, auffassen, was einem da gesagt wird und dann im Zweifel "Respektvoll konfrontieren" oder dann nimmst du eine Anleihe bei Timothy Garten Ash, dem mit robuster Zivilität zu begegnen, das mochte ich auch.
Wie passt es aber zusammen mit dem was du auch empfiehlst, nämlich wohlwollend zuzuhören?
Ich denke, das ist für was wie eine kleine Stufenlehre, ja, auf der Tat, am Anfang wohlwollend die Kontexte ausleuchten, um die New-Horse ringen.
Aber du hast es erwähnt und zitiert, manchmal muss man Quatsch, einfach Quatsch und hasse einfach Hetzeln.
Und manchmal, und dazu ist dieser gesellschaftliche Moment zu bedeutsam, ist es eben auch falsch, sich einfach nur innerlich die Uhr zuzuhalten, sich opportunistisch wegzuducken.
Dann ist die Konfrontation notwendig.
Die Frage ist nur, wie geht man in die Konfrontation, ohne auf den Teufelskreis der pauschalen Abwertung einzusteigen?
Und das meine ich mit dieser Zukunftstum der "Respektvollen Konfrontation", also sich nicht wegzuducken, sagen, was zu sagen ist, aber eben die Position des anderen, womöglich scharf kritisieren, ohne die Person den ganzen Menschen abzuwerten, die Abwertung des ganzen Menschen, der Charakterverdacht, die fundamentale Urteilung, weiße Alter, manisterische, feministischen, woge Klima, Terroristen, frustrierte Ostdeutsche.
All diese Divamierungsvokabeln sind ein garantiert sicheres Rezept, um das Kommunikationsklima weiter zu ruinieren.
Also respektvolle Konfrontation ist so ein, aus meiner Sicht hoffentlich noch ausvollreichend respektvolles Mittel der Auseinandersetzung, die man manchmal in einer gewissen idealerweise sachlich getragenen Schärfe führen muss.
Wir hören immer auf damit, dass wir die Titelfrage nochmal wiederholen und fragen dann, wo stehen wir da in einem Jahr?
Also wie geht Gutes zu hören?
Wo stehen wir da in einem Jahr?
Ja, ich habe es erwähnt.
Ich bin prinzipiell Optimist.
Sehr gut.
Insofern, es wird hoffentlich alles ein bisschen heller, besser.
Bernhard Perksen war bei uns.
Danke dir, Bernhard, sehr für die viele Zeit, die du dir genommen hast.
Redaktionsschluss für die Folge war Donnerstag der 17.
Juli um 15 Uhr und die Redaktion hat gemacht mit Lisa Görleyen, Executive Producerin ist Marie Schiller, Producer Lukas Hambach und Patrick Zahn, Sounddesign Hannes Husten, die Vermarktung macht für uns die Mitvergnügen.
Wenn er also Werbung schalten wollte, dann wendet euch an die und das Ganze ist eine Produktion der Wilmedia GmbH.
Danke dir, Bernhard.
Ich danke dir.