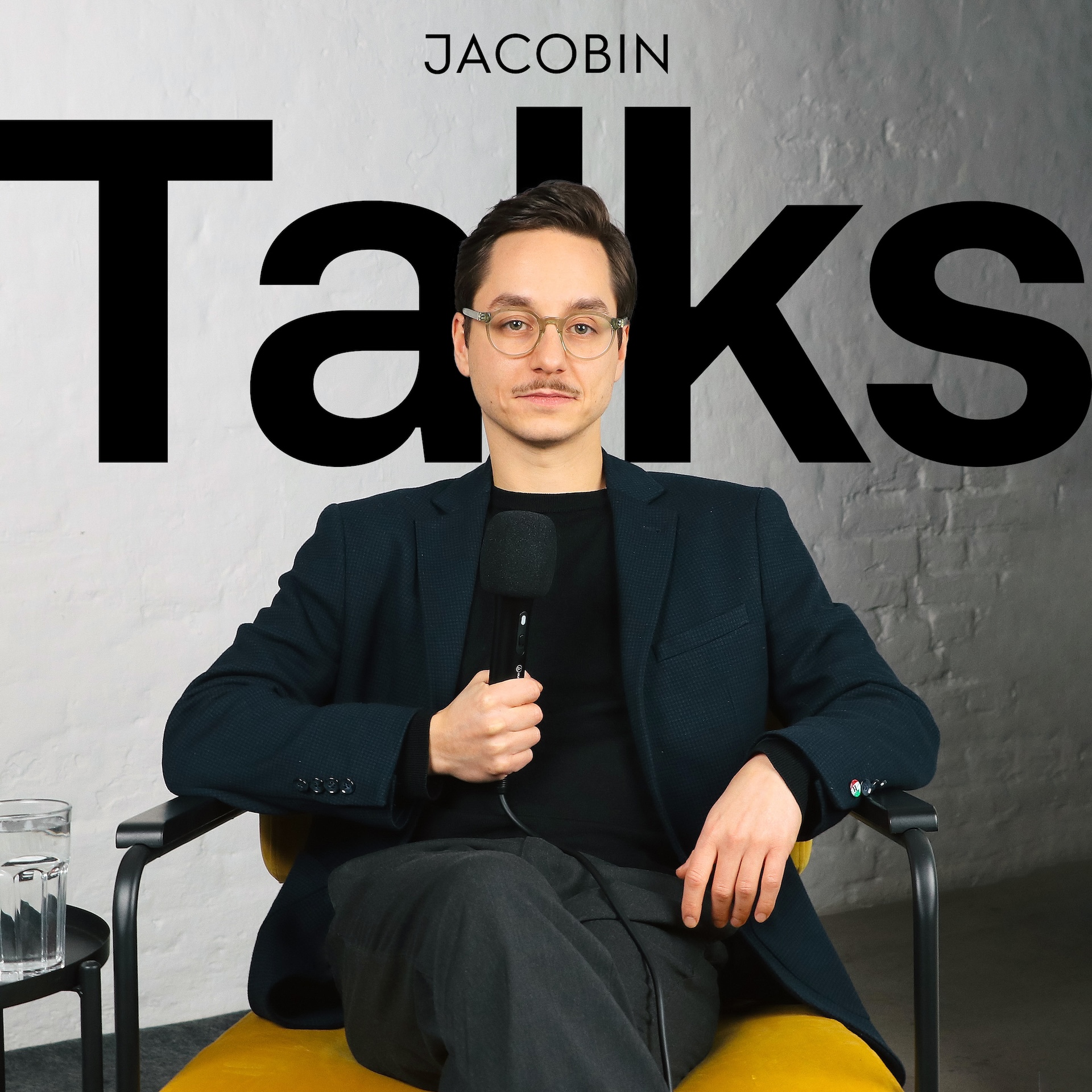Episode Transcript
In einem liberalen Sozialismus hat jeder das rechnen Betrieb zu gründen.
Es gibt noch eine Idee von unternehmerischer Freiheit.
Aber wenn man Betrieb gründet, dann findet es in genossenschaftlicher Form statt.
Herzlich willkommen zu Jacob & Talks.
Hallo, Halle.
Hallo, Matthias.
Heute ist Hannes Kuch zu Gast.
Er ist Philosoph und hat das Buch Wirtschaft, Demokratie und liberaler Sozialismus geschrieben.
Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich wirklich sehr begeistert bin und mich riesig auf das Gespräch freue, weil es meine wichtigsten Leidenschaften vereint, nämlich Hegel und Wirtschaftsdemokratie.
Ja, es ist sowohl eine kluge und originelle Rekonstruktion der Hegelischen Rechtsphilosophie und es behandelt eben die wichtigste und zentralste Frage unserer Zeit, nämlich wie wir den Kapitalismus demokratisieren und damit transformieren können.
Bevor wir inhaltlich aber einsteigen, noch ein kleiner Werbeblock, ihr seht, wir haben eine neue Ausgabe, die Partei die wir brauchen.
Und auch da sind natürlich wieder wunderbare Texte versammelt.
Nils Kumbkar schreibt darüber, welche Polarisierung der Linken nutzt.
Anton Jäger schreibt darüber, wie Organisierung in Zeiten von Hyperpolitik möglich ist.
Und Nina Scholz hat eine kluge Analyse darüber geschrieben, ob es für die Linkspartei gerade besser ist, mitzuregieren oder ob sie in der Opposition bleiben sollte.
holt euch die Ausgabe gerne über den link checkupin.de-slash-talks, damit unterstützt ihr bekanntlich auch dieses Format und helft, dass es uns weitergeht.
So, das war's mit der Werbung und Hannes, wir steigen gleich ein.
Es ist ja so, dass es in der philosophischen Tradition, so startest du auch in deinem Buch, in der philosophischen Tradition der Linken eigentlich ein Modus gibt, den man als Modus der Kritik beschreiben könnte und sehr selten wird eigentlich eine reale Utopie oder eine reale Vorstellung davon entwickelt, wie zum Beispiel eine nicht kapitalistische Wirtschaft aussehen könnte.
Jetzt habe ich dazu zwei Fragen.
Warum ist das so und warum machst du es jetzt anders?
Ja, es ist wirklich eine lange Tradition in der Linken, sich auf die Kritik zu fokussieren, auf die bestimmte Negation, wie Adorno sagt.
Das hat wahrscheinlich stark zu tun mit den Anfängen bei Marx, bei dem einfach Kritik sehr stark im Vordergrund stand.
Das wurde dann nochmal sehr, sehr heftig verstärkt durch die frühe kritische Theorie.
Es gab auch immer natürlich systematisch gute Gründe dafür, sich auf diese negative Dimensionen zu konzentrieren.
Bei Marx, glaube ich, war ein ganz wesentlicher Punkt die Frage nach der besseren anderen Gesellschaft, nach der Utopie auszuglammern, weil glaube ich sehr stark die Idee da war, dass im Kapitalismus sich Produktivkräfte und andere reale Potenziale zu einer anderen Gesellschaft quasi naturwüchsig herausbilden und der Kapitalismus in sich dermaßen widersprüchlich und negativ ist, dass eigentlich vollkommen klar sein sollte, dass eine andere Gesellschaft.
sowohl machbar ist als auch wirklich wünschenswert und besser ist, indem sie die Frage übrigt sich sozusagen.
Dann gab es natürlich auch noch andere Gründe dafür, weil es gerade Marx auch sich so stark von der Tradition des Utopismus abgrenzen musste, der so sehr sich so einen schönen Sonntagsreden vergossen hatte.
Und da gehen viele Probleme mit einher.
Aber die Zeiten haben sich sehr stark geändert.
Wir haben heute zu tun immer noch mit einem realen Erbe.
des Staatssozialismus, der gescheiterten letzten großen Utopie mit der Zeit nach, und immer noch so einen großen Pessimismus und so eine...
So ein Gefühl von Alternativlosigkeit, mit der er die Linke seitdem jener zu kämpfen hat, also nach neun an achtzig zu kämpfen hat.
Und da muss man dagegen halt.
Da muss man heute, in der heutigen Zeit wirklich mutig sein, Mut zur institutionellen Fantasie haben, zur Kreativität sich so ein bisschen auf das Dünne-Eis begeben.
Ja, und auch die Karten auch in Tisch legen.
Ich glaube, das ist so die andere Seite, nicht nur so Mut zur Fantasie, aber auch die Fähigkeit haben, so ein bisschen offen zu lügen.
zu explizieren, welche Gesellschaft man anstrebt mit welchen Argumenten auch, damit sozusagen für den für den Gegner, aber auch für mögliche Partnerinnen Allianz, Allianz Partner verbündete.
Klar wird, wofür kämpft man eigentlich, welchen Gründen, was könnten die Probleme sein, dass man will, ich eigentlich weiß und auch sozusagen mit.
...
mit guten Gründen nachvollziehen kann, in welche Richtung geht das eigentlich?
Wo ist es vielleicht umjusieren für Varskämpfe hier eigentlich?
Das ist so die zentrale Idee hinter dem Buch und auch der Ausgangspunkt, ...
...
um dann letztlich in eine Richtung des zu liberalen Sozialismus zu denken.
Ich meine, das habe ich bei dir auch jetzt noch mal so neu gelernt auch, ...
...
dass sozusagen vielleicht die frühere Tradition, also bei Marx und Co., ...
Und auch die Arbeiterbewegung damals, ja, eben dachte er, gut, der Kapitalismus steht kurz vorm, das war sozusagen auch einfach ein reales Gefühl von, das wird eben sich über kurz oder lang, also eher kurz jetzt abschaffen und neu transformieren, neu gestalten.
Und dann war vielleicht dieses Bedürfnis auch gar nicht so groß.
Und wir leben eben in dieser, there is no alternative nach dem zweiten Alter des Stadtsozialismus, wo das die Linke vielleicht auch neu lernen muss.
Und jetzt hast du ja eine spezifisch philosophische Perspektive, die du auch im Buch entwickelt.
Also über die, wie genau man eine andere Wirtschaft sozusagen gestalten könnte.
Darüber sprechen wir am Ende des Gesprächs.
Und wir gucken aber mal, was für eine philosophische Perspektive du eigentlich einnimmst.
Und natürlich, du hast es jetzt schon genannt.
Marx ist für dich extrem wichtig, aber eben auch Hegel.
Vielleicht kannst du mal sagen, vielleicht fangen wir mal mit Marx an.
Das ist vielleicht einfacher und dann gehen wir über zu Hegel.
Wie sehr deinen deiner Sicht da eigentlich prägt in dem Buch.
Also Marx ist, glaube ich, jetzt klar, dass es für mich wichtig ist, für jemand, der versucht, in der heutigen Zeit auch Kapitalismuskritik zu entwickeln.
Da ist natürlich Marx die erste Anlaufstelle und derjenige Marx, der ganz stark den Fokus darauf legt, welche strukturellen, zwänge strukturellen, systemischen Eigenlogiken eigentlich mit Kapitalismus einhergehen, also nicht nur Fragen von Klassenherrschaft.
Thematisieren ist natürlich wichtig, sondern auch die Frage stellen, inwiefern sich bestimmte.
Zwangsdynamiken, sozusagen hinter dem Rücken aller Akteure durchsetzen.
Dafür ist Marx wichtig.
Aber für mich war ein bestimmter Marx wichtig, den ich schon immer so von Hegel her gelesen habe.
Und da wird es wirklich ungewöhnlich und auch interessant, glaube ich, für viele, weil für mich die Frage immer war, wie man so die Hegelische Idee von Sittlichkeit kombinieren kann mit dem magischen Kapitalismus.
Kritik und das ist glaube ich wirklich ungewöhnlichen der Linken.
Sittlichkeitstheorie bei Hegel heißt jetzt für mich vor allem die Frage zu stellen, was die gesellschaftlichen Bedingungen dafür sind, dass wir in unserem demokratischen Zusammenleben so was wie ein, ich nenne es lebendiges, etwas demokratischer Gerechtigkeit herausbilden, aufrechterhalten, am Leben erhalten und auch sozusagen wirklich spürbar in den im Zusammenleben sozusagen weiter tragen.
Ja, das ist das so ein bisschen die Hauptidee, die ich von Hegel mitnehme.
Da müssen wir sicher noch mal ausführlich darüber reden, weil Hegel wahrscheinlich vielen Zuschauerinnen gar nicht so ein Begriff ist, dann gibt es so bestimmte Vorurteile gegenüber Hegel.
Sie sind auch immer gar nicht so ganz unberechtigt, natürlich.
Man muss da schon gucken, welchen Hegelmann da aus welchen Gründen sich nimmt und liest.
Aber mit diesem sitzlichkeitsdirektischen Blick finde ich, kann man dann noch mal eine ganz, ganz bestimmte Lesart von Marx möglich machen, die ich für sehr wichtig und sehr produktiv halte.
Weil die deutlich machen kann, dass wenn man mit Marx sozusagen zu Recht über Ausbeutung redet, was man machen sollte, dann geht es natürlich um Ausbeutung.
In dem Sinne, dass es wirklich, dass damit reales Elend produziert wird, dass es Ungerechtigkeit geht, das aber auch, und das finde ich schon wichtig, dass da sowas entsteht wie verzerrte Etosformen, der moralische Habitus der Akteure.
wird in Mitleidenschaft gezogen, und zwar auf allen Seiten der Beteiligten, diejenigen, die wir ausgebeutet sind, die sich unterworfen fühlen, die sich ganz passiv fühlen, ein Fatalismus entwickeln, sozusagen so eine Wut entwickeln, vielleicht auch irrationale Wut entwickeln, aber auch auf der anderen Seite der mächtigeren Seite eine bestimmte Form von Arroganz, von Selbstbereicherung, Bestriebungen.
Und das sind alles Haltungen, Ethosformen, die Problematisch sind, wenn wir darüber nachdenken, welche Form von demokratischen Gemeinwesen wollen wir eigentlich, können wir, können wir auf welche Weise verwirklichen.
Ja, lass uns da gerne ein bisschen tiefer einsteigen.
Ich meine, genau, was wir natürlich von Marx haben, das muss man in diesem Podcast wahrscheinlich nicht mehr sagen, ist die Analyse der Klassenspaltung in Eigentümer und Arbeiterin, aber auch den Begriff von Ausbeutung, den du nochmal anders neu sozusagen fast und für dich eine Anspruch nimmst, aber eben Der zentrale Begriff ist bei dir schon die Sittlichkeit von Hegel.
Und vielleicht, ja, versuchst du es einfach mal zu erklären, was das bedeutet.
Denn ich würde sagen, du hast es ja gerade angedeutet.
Es geht eigentlich darum, wie wir uns als Subjekte verhalten.
Und da hat ja Marx dann tatsächlich gar nicht so viel zu sagen.
Ja.
Genau.
Ich glaube, die Schwierigkeit bei Hegel ist immer das viele in der Linken bei Hegel immer so einen Verdacht haben.
Der ist so einen...
So ein legitimierer, so ein rechtfertiger, desgegebenen Damals zu Hegel seit des polsischen Staates, des der Monarchie jetzt in heutiger Zeit die Hegelianer, die dann eine bestimmte Form von traditioneller Sozialdemokratie wiederbeleben wollen oder rechtfertigen wollen.
Deshalb hat Hegel immer so ein leicht strukturkonservativen Touch.
Für mich als großer Schischek-Fan ja nicht.
Genau, dann gibt es die Schischek-Tradition oder es gibt noch diese linkshegeleanische Tradition.
Da wird aber Hegel oft so verstanden, dass so bei Adorno vor allem auch bei Schischek tendenziell schon auch, dass so gedacht wird, Hegel hat so indirekt und unbewusst eine bestimmte Form von Kapitalismus-Kritik.
vorweggenommen, das so ein Dämmern des kritisches Bewusstsein der Gesellschaft.
Das ist ja auch alles richtig.
Auch dieser strukturkonservative Hegel, da ist auch nicht ganz falsch.
Das sind aber nicht die Dimensionen, die ich an Hegel relevant und spannend finde, sondern der Hegel, den ich wichtig finde, ist der der Frage nach den vernünftigen Strukturen eines Gemeinwesens.
Das Freiheit verwirklicht und zwar Freiheit in allen relevanten Dimensionen, Freiheit als Freiheit des Individuals, aber jetzt nicht nur.
persönliche Wahlfreiheit, negative Freiheit, sondern auch schon andere wichtige Freiheitsformen wie moralische Freiheit oder politische Autonomie im gemeinen Wesen.
Und da ist für Hegel ganz interessant, weil du hast jetzt diese Idee der Ficklichkeit, die ich schon kurz angesprochen hatte.
Die hast du ganz kurz so reforminiert, als würde es da um das Verhalten einzelner gehen.
Ja und nein, schon auch, das ist schon richtig.
Es geht natürlich um das Verhalten einzelner auch um die...
sozusagen moralischen Überzeugungen, die sind schon auch wichtig von Einzelnen, aber was ich den ganz wichtigen Punkt finde bei Hegel ist, die Idee zu sagen, dass wenn wir über sowas wie eine moralische Autonomie reden oder eine gute vernünftige Form der politischen Autonomie, dass wir dann immer über Strukturen und Institutionen des Gemeinwesens reden müssen, die auf eine bestimmte Weise ethisch moralisch imprägniert sein müssen und zwar deshalb, weil wir als Individuen in diese Strukturen reinsozialisiert werden, eingewöhnt werden, reinwachsen und je nachdem, welche moralische Qualität diese Strukturen haben, wir auch zu einer bestimmten Qualität des Zusammenlebens befähigt werden.
In dem Sinn geht es um so eine ganz intime Verquickung von von Gesellschaft und Individuum.
Also es geht schon um moralische Frage, in dem es um das Individuum und auch um moralische Überzeugung von einzelnen, aber unter einem Blick der sagt, wir müssen erstmal beim Ganzen antreten.
Bei den Grundstrukturen der Gesellschaft, die müssen auf eine bestimmte Weise beschaffen sein, die müssen so beschaffen sein, dass wir uns durch diese Struktur noch in bestimmte Weise bilden, aber eben in einer ethisch-moralischen Hinsicht.
So ist die Grundidee und zwar nicht, nicht in der hin sich das vereinfacht.
sagen wir, Wir finden diese Strukturen von einer bestimmten moralischen vernünftigen Falligkeit schon da draußen, das wirklich ist vernünftig, heißt es ja.
Bei Hegel ist es nicht so gemeint, dass das real existierende wirklich da draußen schon vernünftig wäre, sondern es ist gemeint, wenn wir über boralische Potenziale der Wirklichkeit reden, dann können wir feststellen, dass es tatsächlich bestimmte Potenziale in der Wirklichkeit gibt.
Die können wir auch angeben.
Das heißt aber nicht, dass alles, was da draußen gerade so faktisch partiert, doch schon gut und schön wäre.
Also, deshalb ist es schon eine ungewöhnliche Hegelisart und für die meisten Zuschauer wahrscheinlich ungewohnt.
Aber ich meine, korrigiere mich gerne, wenn ich sitze, ein bisschen zu sehr vereinfach, aber ich meine, im Prinzip geht es ja darum erstmal auch, was fast banales zu sagen, nämlich natürlich ist es verhalten und die Art und Weise wie unsere Wertvorstellungen sind und so weiter davon geprägt, wie die gesellschaftlichen Institutionen halt gestaltet sind, in denen wir uns bewegen, sozusagen.
Und vielleicht können wir das um das, was das ist jetzt ganz abstrakt gefasst, um das ein bisschen deutlicher zu machen, ist ja...
der total originelle und für mich wirklich originelle und neue punkt den du machst eben zu sagen na ja was tun wir den ganzen tag?
wir bewegen uns in der wirtschaft also wir sind wirtschaftssobjekt entweder als freie lohnarbeitende oder als eigentümer.
möglicherweise soll es ja geben und da ist kommt genau das ins spiel.
da entwickeln wir eine gewisse siddlichkeit und du sagst diese.
deswegen ist die ökonomische sphäre auch eine sphäre der bildung.
vielleicht kannst du das mal ausführen was das heißt genau.
Also Bildung ist auch ein Begriff, den ich von Hegel an der Stelle übernehme.
Der ist jetzt aber in einem zweifachen Sinne verwendet.
Die erste Sinne ist erstmal ganz einfach und simpel, soll erstmal nur heißen, dass es da um Prozesse geht der Formierung.
Da passiert was mit uns.
Wir werden in der Sphäre der Wirtschaft zu bestimmten Subjekten gemacht.
Wir verändern uns dadurch die Umgebung, in der wir agieren.
Also Bildung erst mal im Sinne von Formierung, eher so ein Anfoko-orientierter Begriff.
Der Bildung aber mit Hegels.
eben der Punkt, wenn es um einen moralischen Habitus, um etwas geht, dann muss es da um mehr gehen als bloße Formierung, die sich irgendwie vollzieht, sondern es ist ein Bildungsbegriff, der fragt eine Formierung im Hinblick auf was.
und da kommt dann eben nochmal diese eine.
Poarte, die ich jetzt schon erwähnt hatte, in Spielformierung im Hinblick auf die notwendigen subjektiven Bedingungen für ein gelingendes vernünftiges demokratisches, der gemeinwesen und dann verbunden mit der Proahnte.
Klar, es ist so ein relativ einfach Grundgedanke, die Grundstrukturen, in denen wir leben, die prägen uns, die formen uns, die sollten nicht einfach nur Formierungsprozesse sein, sondern Bildungsprozesse im Hinblick auf dieses ideal vernünftiger demokratischer Zittlichkeit.
Aber vor allem die Grundstruktur Das Wirtschaftsleben, weil das die Sphäre ist, die für uns als Subjekte ganz, ganz entscheidend ist, eine sehr hohen Stellenwert hat, weil da einfach wahnsinnig viel mit uns passiert.
Es hat unterschiedliche Gründe, man kann damit anfangen, dass es die Sphäre ist, bei der sehr, sehr viele erwachsene Personen einfach...
gezwungen sind, teilzunehmen.
Es gibt eine äußere Notwendigkeit der Teilnahme in diesem Bereich.
Das gilt so für fast keine andere soziale Sphäre.
Man ist vielleicht, dass ein Bedürfnis macht Liebe und man fühlt so eine, genau so ein Bedürfnis, Liebesbeziehung zu pflegen.
Man kann aber auch ein paar Jahre ohne Liebesbeziehung leben.
Was geht?
Ja, und so geht es für viele sozialen Sphären, aber bei der Arbeitsphäre ist es ein gewisses Zwang.
Man kann weitermachen bei der ...
und by the ...
...
you know.
Bei einem Umstand, dass ja einfach der zeitliche, die zeitliche Eingewundenheit wahnsinnig groß ist.
Wir sind einfach sehr viele Tage, sehr viele Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche, viele Wochen im Jahr, ein Großteil des Erwachsenerlebens eingebunden.
Man kann weitermachen mit dem Umstand, dass die Dichte der sozialen Kooperation im Arbeitsleben einfach wahnsinnig großes, starkes Nervissinter umstellt von sehr, sehr vielen Normen auf der Team-Ebene, auf der betrieblichen Ebene.
auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene.
Also in dem Sinn gibt es da sehr viele Faktoren, die letztlich dann deutlich machen, dass das die Sphäre ist, auf die wir wirklich gucken müssen und schauen müssen, was passiert da eigentlich im Hinblick auf Sicklichkeit.
Und die Proorte ist natürlich bei dir eine sehr, wie soll ich sagen, fast tragische, weil man eben sagen muss, ja, wir wingen uns alle und müssen uns in einer kapitalistischen Wirtschaft in irgendeiner Weise so formieren, wie du es gerade beschrieben hast.
Und es trägt aber überhaupt nicht dazu bei.
jetzt mal überspitzt formuliert, dass wir zu demokratischen Bürgern werden.
Und darin zielt ja sozusagen eine philosophische Analyse, die das erstmal sehr schön begrifflich alles auf, rollt ja mitten ins Herz der Gegenwart, weil wir, ne, das ist ja die, ich mach jetzt mal den größeren Rahmen auf, damit wir das für die Zuhörer präsent haben.
Es ist ja gerade die Frage, wir haben eine Demokratie mit einer kapitalistischen Wirtschaft gepaart und die Demokratie hat gewisse Bedingungen, wie sie funktionieren, die erfordert auch gewisse...
bürgerliche Subjekte, die sich irgendwie beteiligen anwahlen oder wie auch immer sich bilden und so.
Und die kapitalistische Wirtschaft scheint das aber zu verhindern auf dieser Subjekt-Ebene, wenn ich dich da richtig verstanden habe.
Genau.
Das ist die kritische Seite der Analyse, die negative Seite der Analyse in meinem Buch.
Also, wenn man im Einzelnen sich anschaut, in welchen Facetten eigentlich dieser erforderliche Habitus, von dem ich jetzt moralische Habitus, von dem ich gesprochen hatte, In Mitleidenschaft gezogen wird, deformiert wird durch die Strukturen, die wir in der kapitalistischen Wirtschaftswelt haben.
Genau, dann muss man einfach eine sehr negative Diagnose haben.
Das fängt an auf der Ebene des Betriebs, wo wir einfach sehen, dass innerhalb des Betriebs diese hierarchischen Strukturen zwischen Management und zwischen einfachen angestellten Lohnarbeiterinnen.
existieren, wo wir ganz zurecht davon gesprochen werden.
Man muss einfach von einer sozusagen Diktatur des Sportiers, des Managements sprechen, des politischen Vollmachten sprechen.
Es steht auch eigentlich direkt so im bürgerlichen Gesetzbuch.
Das ist eigentlich auch alles so ein mehr oder weniger offenes Geheimnis über ein bisschen weniger sichtbare Strukturen, nämlich Eigentumsstrukturen, das hinter dem Management natürlich bestimmte Eigentumsinteressen stehen, ein Gegensatz zwischen.
Kapitaleigentümer, Klasseschicht einerseits Klasse der Lohnarbeitenden, andererseits die mit bestimmten Imperativen von Ausbeutung einhergehen.
Das ist eine bestimmte Unternehmestiktatur zu einem bestimmten Zweck, nämlich Profiterwirtschaftung auf dem Rücken von Lohnarbeitenden.
Aber dann auch, wenn man über die betriebliche Ebene hinausgeht, wie sind eigentlich diese einzelnen wirtschaftlichen Einhalten, wie sind die zueinander, die Betriebe zueinander, die die ManagerInnen zueinander, die Lohnarbeitungsobjekte zueinander.
Es sind Konkurrenzverhältnisse.
Wir sind dann im Verhältnis zu anderen, in denen wir, Verhältnisse in denen wir gezwungen sind, so latent, so feinzielige.
Beziehungen zu anderen, zu entwickeln, wo der Schaden des anderen, mein potenziell, mein eigener Vorteil wäre, bis hin zu wirklich auch dieser materiellen Dimension, dass das sowas gibt wie Unterbietungs-Wettbewerbe oder auch der tatsächliche Schaden des anderen, dann mein realer Vorteil wird.
Diese ganzen Dinge, die muss man sehr, sehr gezielt den Blick nehmen, aber eben immer auch unter dem Vorzeichen der Sittlichkeit.
So ist die negative Analyse.
Ich meine, ich habe mich, muss mich ja viel mit, als Wirtschaftsjournalist, gerade viel mit den Silicon Valley-Unternehmern auseinandersetzen und da findet man ja quasi so in der Empirie den Prototyp eigentlich von einer sowas von deformierten Subjektivität, die eben genau aus einem extremen Konkurrenz starken wirtschaftsbereich quasi Menschen, also autoritäre Männer produziert hat, die Demokratie natürlich gerade zerstören.
Also das ist eigentlich...
Das liegt heute fast so offen auf der Hand.
Man muss nur noch kurz mit dem Finger darauf zeigen, um so eine Evidenz zu schaffen.
So eine vollkommen Welt enthobene...
Es ist auch immer eine Form von Männlichkeit, so eine Idee von Coolness, von Arroganz auf die anderen herabblicken.
Auch diese Idee von manchmal, das ist das eine Genialität, als jemand...
so eine, so eine angeborene Vorrechte, einfach so den anderen Leuten vorzuschreiben, Kraft eigener Genialität, wohin der Weg dann führen soll diese Dinge.
Ja, und aber auf der anderen Seite bestimmte Entwicklungen von autoritären Verhaltensmustern, in größerem Teil der Bevölkerung, der aber jetzt nicht daran liegt, dass die Leute Charakterdefizite hätten oder man, die einen persönlichen Vorwurf machen müsste, sondern es sind bestimmte Reaktionsformen darauf, wie sich kapitalistische Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, mit neoliberalen Strukturen, die sich immer stärker durchgesetzt hatten, so eine Idee von Selbstverantwortung, von Leistung, wo es für viele Subjekte, die irgendwie so zur Mittelklasse, unterer Mittelklasse gehört hatten, glaube ich irgendwann mal so naheliegend war, zu sagen, na ja, in diesem Spiel von sowieso einen Kampf aller gegen aller, so ein Naturzustandsspiel, Da kann ich eigentlich am besten mithalten, nicht wenn ich diejenigen kritisiere, die wirklich meine Gegner wehren, nämlich die mit mir macht und die, die mich ausbeuten, sondern wenn ich die kleine Macht, die ich habe, nutze, um nach unten zu treten und auf die angeblichen Asyl.
Schmarotzer, Sozialschmarotzer, zu belegen und die zu kritisieren.
Das sind so der Nährboden des Autoritarismus.
Da ging es los in den Achtziger, Neunziger Jahren und heute hat sich das immer offener durchgesetzt.
Um diese Erscheinungsform geht es von der Formierung des Sabitus.
Ich meine, was ich auch so interessant fand bei dir, was ich auch für ein philosophisches Buch sehr ungewöhnlich fand, ist diese, dass du ja dir auch Studien angeguckt hast zu, wie sich Menschen wirklich verhalten unter sozusagen Sag ich mal, Strukturen, kapitalistische Bedingungen.
Du hast ja da so bestimmte Versuchsordnungen mit Spielen angeguckt.
Vielleicht kannst du da zu was sagen, weil ich das finde ich total interessant in diesen Studien.
Ja, das ist ganz interessant.
Das gibt ja in den Wirtschaftswissenschaften und auch in der Psychologie so eine neuere Forschungsrichtung, Verhaltenspsychologie, Verhaltensökonomie, wo so geguckt wird, dass man Leute wirklich sozusagen überzeugt geht um ein Labor.
Wir gucken an, wie ihr euch verhaltet und also sehr, sehr Stilisierten Bedingungen und es wird immer danach geschaut zu gucken, was sind denn die kooperativen Potenziale oder die Potenziale zu einem reinen sozusagen eigeninteressierten Verhalten?
und durch diese leichte leicht stilisierten Spiele, die dann oft gespielt werden.
Kann man schon ziemlich gut rausfinden, inwiefern eigentlich der institutionelle Kontext.
doch eine erhebliche Rolle dafür spielt, die sich dann die Akteure verhalten.
Und eine hauptpaulante Fieler dieser Untersuchungen ist eigentlich das Gezeichte, dass am Anfang die allermeisten Akteure doch ein erhebliches kooperatives Potential haben.
Einerseits wäre es die Kuppe so, der wirklich durch und durch...
moralisch überzeugten subjekte gibt der heiligen wird dann man auch gesagt die immer moralisch korrekt handeln egal wie sich die anderen erhalten.
dann gibt es auch die größere gruppe der subjekte den kooperatives potenzial haben Aber unter der Kurannahme, wie sich die anderen verhalten.
Und dann gibt es eine kleinere Gruppe, die tatsächlich zum stark eigeninteressierten Verhalten tendiert.
Aber die Portante ist dann oft zu sagen, dass anfänglich dieses kooperative Potenzial extrem hoch ist.
Und dass es dann davon abhängt, wie die institutionellen Strukturen sind, ob dieses kooperative Potenzial aufrecht erhalten wird.
Und wenn die Strukturen die falschen sind, dann kann man aber sehr schnell die Dynamik feststellen, der sozusagen des Niedergangs und der Erosion dieser kooperativen Potenziale.
Und am Ende sieht es dann nach wenigen Runden der Spiele, sieht es dann so aus, als wären alle Akteure furchtbar egoistisch, so wie es die Wirtschaftswissenschaften unterstellt.
Situation ganz dramatisch.
Das stimmt aber nicht.
Das ist nur das Endergebnis von bestimmten Spielanordnungen.
Am Anfang stehen eigentlich erhebliche kooperative Potenziale.
Das ist wirklich ganz interessant.
Man kann das da ganz direkt in diesen sehr gut, so konstruiert und auch gut rekonstruierbaren, spielenden Experimente beobachten.
Ich kenne das auch durchaus von Freunden aus Erzählungen, die sich dann in der freien Wirtschaft bewegen.
Natürlich, da geht man dann rein und dann ist man aber erstmal in so einem sehr konkurrenzlastigen Unternehmen zum Beispiel so und dann merkt man ja, die anderen verhalten sich halt auch scheiße und irgendwann denkt man sich ja gut, dann mach ich's halt auch.
Das ist ganz platt, sag ich mal so.
Ja, und jetzt lass uns nochmal sozusagen den größeren auch den philosophischen Rahmen mit reinholen.
Jetzt haben wir das gesehen.
Auf der einen Seite haben wir eine kapitalistische Wirtschaft, die sozusagen deformierte Subjekte oder eine defizitäre Sittlichkeit philosophisch gesprochen hervorbringt.
Auf der anderen Seite haben wir ein demokratisches System, das eigentlich auf sowas angewiesen ist wie ein Citoyant, wie eine Bürgerlichkeit, wenn man es ganz klassisch will, die noch auf das Allgemeinwohl in irgendeiner Weise bezogen ist.
Also anders geht es dann halt nicht.
Und das Gerät, wie wird das jetzt am schönsten bei, ich bin den Silicon Valley Unternehmern sehen sozusagen in irgendeiner Weise auch in der Gegenwart einfach nicht nur in der Gegenwart, aber jetzt auch wieder besonders in den Konflikt.
Und jetzt haben wir ja sozusagen eine Tradition.
Vielleicht auch aus der Systemtheorie, die du auch mit einbeholst, wo man sagt, ja, gut, es gibt so verschiedene gesellschaftliches Fähren mit ganz verschiedenen Logiken.
Und du würdest ja sagen, aber um dieses Problem zu beheben, braucht es ja eigentlich was anderes.
Und da finden wir eigentlich auch bei Hegel schon die Idee.
Ja, vielleicht kannst du das mal erläutern.
Genau, das ist gut.
Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, dass du da kurz das Stichwort Systemtheorie erwähnst.
Das ist gar nicht so ganz unrelevant.
Auch das glaube ich ist gut.
Zuschauer in den gar nicht so vor Augen, aber wenn man jetzt eher an doch relativ bekannte Denker wie Jürgen Habermas einerseits und John Rawls andererseits denkt, die ich in dem Buch in großen Teilen kritisch analysiert habe, also die ich auch in vielerlei Hinsicht ganz wichtig und toll finde, aber die sind interessant, weil bei denen eine sehr starke, normativ überzeugende und auch gut begründete Normative Analyse vorhanden ist, was Demokratie und Gerechtigkeit betrifft, aber andererseits eine sehr große Bereitwilligkeit.
viele Annahme in einerseits eben aus der Systemtheorie zu übernehmen, andererseits aus der neoklassischen Wirtschaft zu übernehmen, wie man jetzt heute auch immer noch in den Lehrbüchern der Wirtschaftswissenschaften findet.
Also bei Habermas ist es eben vor allem so zoologische Systemtheorie, hat er sich zu viel mit Lohmann auseinandersetzen müssen und hat dann da ein bisschen zu viele Konzessionen gemacht, so ganz flach gesagt.
Und bei Rawls ist es wirklich, da merkt man, der hat einfach sozusagen parallel, hat seinen Kanton noch so im Hinterkopf gehabt und dann parallel diese Wirtschaftswissenschaften, Lehrbücher.
gelesen, das ist wirklich der Eindruck.
Und dann hat man den Eindruck, die haben versucht, sozusagen an diesen stark normativen Prämissen, die wir zu Recht haben und an denen die festhalten wollen, festzuhalten, aber in der Weise, dass diese system theoretischen und neoklassischen Überlegungen da so wie so wie so ein Bausatz so integriert werden.
Wir nehmen das jetzt mal auf, so einfach, so unbesehen, behandeln das so ein bisschen als Black Box, was wir uns da so mitgeben, aber versuchen das in den richtigen Rahmen einzubetten.
eine Idee von demokratischer Gerechtigkeit und gerechten Strukturen, die wir als Philosophen entwickeln.
Aber der Preis, den dann diese Denkrichtung dafür bezahlt, ist eben, dass man wirklich eine Black Box sich einkauft, mit der Behauptung, na ja, wenn die Wirtschaft so funktioniert, wie die Wirtschaft zwischen Wissenschaft und Sahne, die Neoclassik sagt, dann wird da am Ende es schon so sein, dass es tatsächlich effizient zugeht, dass der Output maximiert wird, dass wird ein möglichst großer Kuchen gebacken.
Und wir in der Gerechtigkeitstheorie oder wir als Bürgerinnen im demokratischen Gemeinwesen, wir gucken dann, wie dieser Kuchen nach gerechten Prinzipien verteilt wird.
Wir interessieren uns aber nicht dafür, was in dieser Black Box da eigentlich passiert.
Dazu kann man nichts sagen.
Das ist sozusagen die Angelegenheit der Systemtheoretiker oder der Wirtschaftswirtschaftler.
Und mit Hegel nochmal ist die Partie zu sagen, man muss von vornherein, von einer viel engeren Verknüpfung der unterschiedlichen.
Sphären ausgehen.
Es ist jetzt nicht so, dass Hegel eine Idee von einer All-Einheit und aufgelösten Sphären hätte, sondern es muss schon unterschiedliche soziale Sphären der Gesellschaft geben.
Aber es ist immer unter dem Blickwinkel gedacht, dass dieses Sphären sehr gezielt und auch auf eine sehr komplexe Weise ineinandergreifen müssen.
und vor allem im Hinblick darauf, was in Wirtschaftsleben passiert.
muss man extrem darauf achten, wie dieses ineinandergreifen eigentlich passiert, vor allem dann wiederum mit Fokus auf die politische Sphäre.
Also da hat hier wirklich eine ganz ganz andere, herangehensweise anderen Blickwinkel und mit der muss man diese Idee von sowohl fahrtsmaschinewirtschaft, benutzen die Wirtschaft so als wäre das wirklich eine Maschine, die wir so...
mit unseren Schalthebeln der Macht bedienen können, aber der Politik nichts zu tun hat.
Die mit der Politik im Ehren ist nichts zu tun hat.
und wir können angeblich auch sozusagen ausblenden, was da innerhalb dieser Maschine passiert.
Wir machen uns tagsüber zum Rätchen innerhalb dieser Maschine, aber hoffen dann, dass das der Output des Ergebnisses dieser Maschine, dass das schön und gut und groß ist und dann das verteilt wird.
So funktioniert es nicht, weil die Pante wäre zu sagen, wir sind Teil dieser Maschinerie und wir werden dadurch, was in dieser Maschinerie passiert, mit produziert und mit verändert.
Es werden nicht nur Dinge produziert, sondern wir als Subjekte werden durch diese Maschinerie produziert.
Und ganz konkret heißt das ja auch, dass auch schon Hegel eben eine Vorstellung hatte und da ist er ja sozusagen, finde ich auch immer, obwohl ich großer Marxist bin.
Ist auch und ist jetzt meine Erläufigkeit zu sagen.
Genau, damit ich ja keine Missverständen finde.
Nein, aber...
Da ist er ja dann Marx insofern ein Stück weit überlegen, weil man bei Marx tendenziell, je nachdem wie man es liest, aber schon sagen kann, ja bei Marx geht es am Ende darum, dass die kapitalistische Wirtschaft eigentlich in einer sozialistischen Politik auch aufgelöst wird.
Also die Politik soll am Ende eigentlich bestimmen wie...
Das läuft so und bei Hegel geht es und das finde ich, hast du sehr präontiert auch ausgearbeitet.
Darum, dass dieses Fern eigentlich ineinander greifen.
Also das ist schon eine alte, jetzt können wir mal ganz böse sagen, dass die Politik sozialdemokratisch das Ding reguliert, aber du willst ja auch auch was anderes hinaus sozusagen.
Genau.
Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das wirklich in so Termin von Sozialdemokratie zu machen, denn ich habe jetzt so ein bisschen Hochtraben von Worlds und habe am Mars gesprochen, aber es geht ja eigentlich um so eine sozialdemokratische Traditionsunion.
denen ja, der ja auch Volts und Habermas angehören.
Aber Sozialdemokratie heißt an dem Sinne jetzt wirklich zu sagen, wir akzeptieren erstmal, dass die Wirtschaft als Wohlfahrtsmaschine behandelt wird und wir gucken dann, dass wir so ein bisschen extern regulieren, also zum Beispiel möglichst scharfe, starke Arbeitsschutzgesetze machen und dann gucken, ob unsere steuerweltlichen Maßnahmen gut genug sind, um die notwendigen Umverteilungsmaßnahmen hinzubekommen.
Aber es ist eben ein Verhältnis zur Wirtschaft.
Bei der die Politik nur so von außen, so ein bisschen herum, dort die Rahmenbedingungen verändert und nicht diese interne Transformation der Wirtschaft hinbekommt, für die ich eigentlich lebe.
Und dann, ja, lass uns vielleicht sozusagen, lass uns dann ruhig jetzt mal reingehen in die Warum wir das ja jetzt gemacht haben sozusagen oder warum du diesen diesen Begriff, das können wir vielleicht auch gleich noch diskutieren, wenn wir die verschiedenen Alternativen, System Alternativen anschauen, die du diskutierst, warum wir den Sittlichkeit Begriff da brauchen, wie wir das jetzt versucht haben, auch nochmal aufzurollen.
Das machen wir auf jeden Fall, aber lass uns dann auf die beiden Alternativen zum Kapitalismus mal eingehen, die du beschreibst.
Und wir fangen natürlich wie im Buch auch mit der Eigentümer Demokratie an.
Was ist das denn für eine Idee, woher kommt die?
Ja, das ist interessant, weil diese Idee einer Eigentümerdemokratie oder Eigentumstemokratie Property Owning mit Democracy im Englischen.
In der Philosophischen Diskussion inzwischen schon eine große Rolle spielt.
Das ist ein Konzept, das John Rawls vor allem im Staat gemacht hat.
Da kommt Rawls wieder ins Spiel.
Aber bei Rawls selber ist es auch eher so ein bisschen durch die Hintertür angeführt worden.
In der früheren Theorie der Gerechtigkeit merkt man eigentlich gar nicht, dass es ihm da eigentlich um diese Eigentumsdemokratie geht.
Da denkt man ja, wir würden vom sozialdemokratischen Wohlfahrtstaat reden.
Aber dann in dem späteren Gerechtigkeit als Fairness ist es vollkommen klar, was ihnen vorschwebt als Wirtschaftssystem, ist diese Eigentumsdemokratie der Eigentümerdemokratie.
Und das heißt für WALLS eine wirtschaftliche Grundstruktur, in der der Zugang zu Produktivvermögen mehr oder weniger egalitär organisiert ist.
Aber gleichzeitig...
von der Form des Produktivvermögens an einem Recht auf privateigentum an Produktionsmitteln festgehalten wird.
Also es wird niemanden verboten, zum Beispiel eine Genossenschaft zu gründen oder ein gemeinwollorientiertes Unternehmen, das ist jedem freigestellt, aber es wird auch niemanden verboten, eine klassisch kapitalistische Firma zu gründen.
Es wird auch niemanden verboten, Lohnarbeit in kapitalistischen Firmen zu verrichten, aber innerhalb von Strukturen eben in der alle Bürger in den wesentlichen Egalitären Zugang zu Produktivvermögen haben.
Und das ist schon interessant als eine Form der realistischen Utopie.
Also ist natürlich eine Utopie, weil wir sind weit davon entfernt.
Aber es ist auch eine realistische Utopie, weil...
Wie ist so viel verändert sich auch nicht?
die ganzen grundlegenden Rechtsformen würden eigentlich in dieser Wirtschaftsform erhalten bleiben.
Trotzdem wäre es ein radikaler Bruch.
Viele haben ja auch schon so Aktien oder sowas.
Und sowas würde dann wie ausgeweitet werden, wenn es jetzt ganz vereinfacht sei.
Genau, da geht es aber schon tatsächlich in so ein bisschen kritische Analyse dieser Eigentumsdemokratie.
Ich wollte erst einmal, ich wollte es ein bisschen stärker machen, weil.
Man schon anerkennen muss, dass viele Kritikpunkte, die man so von Marx kennt und die man gegenüber dem Kapitalismus, wie wir ihn haben, so recht haben kann, mit dieser Form von Wirtschaftssystemen erstmal ausgehebelt werden.
Da gibt es dann viele der Probleme, zum Beispiel an Klassenherrschaft, Klassenausbeutung.
In dem Sinn nicht mehr.
Und da muss man dann scheiß mal anerkennen.
Da muss man sich mit diesem System auch wirklich...
Weil alle erstmal Eigentümer sind.
Genau.
Man hat die reale Chance, sich zu entscheiden, will ich jetzt mit meinem alten Kapital, das ich habe, einen eigenen Betrieb gründen?
Will ich das Geld in Aktien investieren?
Welche Art von Lohnarbeit will ich verrichten?
Vor allem habe ich die Chance, wer bekommt man das Geld?
Vom Staat erst mal am Anfang.
Vom Staat organisiert durch sehr, sehr hohe, sehr starke Erbschaftsteuer.
Und das ist die Idee noch mal so ein bisschen plastisch.
Rawls gedacht genommen, dann gibt es sowas wie ein Grunderbe, also ein sehr, sehr hohes Grunderbe von hunderttausend bis zwehunderttausend Euro.
Und je nachdem, wie radikal die Vorschläge sind, aber in achtzig bis neunzig Prozentige Erbschaftsteuern ab einem bestimmten Satz, der nicht auf einer bestimmten Grenze, die nicht allzu hoch angesetzt wäre.
Also in dem Sinn ist es schon wirklich ein...
gerade Kalon auch ein guter Vorschlag.
Und ich finde, dann ist auch gar nicht mehr so ganz einfach, wie soll man eigentlich dieses Modell kritisieren.
Vor allem, wenn man irgendwie sowas wie Sozialismus im Hinterkopf hat und eben mit dem Idee von demokratischer Regierung des Wirtschaftsleben im Hinterkopf hat, weil dort aus der rolesianischen Ecke dann ganz schnell der Vorbehalt akzeptiert wird.
Hier müssen auf die liberalen Grundfreiheiten der Subjekte achten, wenn die Leute einen bestimmten Wunsch haben nach Lohnarbeit, dann sollen die doch gerne Lohnarbeit verrichten, wenn die Leute gerne nach Eigentum oder wenn die gerne ihren eigenen Betrieb gründen wollen und zwar sozusagen nach diesem genialischen Silicon Valley-Muster, ich will König seinem eigenen einen Betrieb und wer da diktatorisch reagieren dürfen, dann sollen die Leute auch da zu ihrer Freiheit haben.
So ein bisschen ist es gedacht und Sozialismus, so wie ich ihn jetzt verstehe.
Es soll ja ein liberaler Sozialismus sein, müssen wir auch noch mal drüber reden.
Aber da werden immer bestimmte Eingriffe mit einhergehen, darin welche Freiheiten Menschen haben, in Bezug auf Wirtschaftsformen.
Also wir haben gute Gründe dafür, Lohnarbeit zu kritisieren und zu sagen, Leute sollen in Betrieben arbeiten, in denen Lohnarbeit erst mal von vornherein ausgeschlossen ist.
Und dafür braucht man gute Gründe.
Also deshalb dieser Gegner, Eigentumsdemokratie, Das ist sozusagen, es ist wirklich alles andere als ein Papkamera.
Nein, das ist ja oft bei den philosophischen Analysen.
Man nimmt sich da so einen leichten Gegner und grenzt sich dann davon ab und macht sich so ein leichtes Spiel.
So soll es wirklich gar nicht sein.
Und das ist man wirklich so gedacht, den wichtigsten und ernsten Gegner, die man derzeit findet.
Von der Systemalternative.
Von Systemalternativen her, die aber auch...
So eine Anschlussfähigkeit haben an liberale Diskurse, auch an Diskurse aus der Mitte und damit so ein bisschen so ein Türöffner sein könnte.
Das ist auch das Schöne.
Man kann dann wirklich auch Leute abholen und sagen, schaut doch mal, euer liberaler Vordenker Rawls hat da von Eigentumsdemokratie gesprochen.
Da war eine Kritik an Klassenherrschaft mit verbunden.
Es war auch wirklich so.
Dann können wir doch mal über die wirklich ernsthaften Dinge reden jetzt gemeinsam über das System Alternativen, über Klassenverhältnisse, über Ausbeutung.
Und dann, da kann man Leute ja auf eine interessante Weise mitnehmen.
Und dann ist der argumentative Schritt zum Sozialismus wirklich gar nicht mehr soweit.
Nee, und ich finde sozusagen ja auch andersrum, also insofern das überzeugend, weil wenn man jetzt, ich sag mal, wir im Jacobin-Context natürlich...
Wenn den Sozialismus nachdenken und die Art und Weise, wie der organisiert sein soll und man natürlich die real sozialistischen Erfahrungen hat und so weiter und natürlich sich für linke heute die frage steht ja so ein wirtschaft muss halt auch effizient sein ja und das ist ja genau ein punkt wo die eigentlichen demokratische vorteil hat weil man relativ viele kapitalistische.
Elemente nun halt behält aber tatsächlich die klassen spaltung in einer bestimmten form überwindet.
Und aber genau, also das ist ja das Attraktiv, wenn man hat das Gefühl, die Dynamik des Kapitalismus, die man ja nicht bestreiten kann, die bleibt irgendwie da.
Und da müssen wir jetzt gucken, was ist da jetzt, wenn wir jetzt diesen Sittlichkeitsdiskurs wieder mit reinnehmen, den wir jetzt so lange auch besprochen haben.
Der ist ja für dich so wichtig, weil er das überhaupt jetzt erst erlaubt, da wirklich zu kritisieren, was den Eigentümer...
Demokratie falsch macht.
Genau.
Und die Idee ist dann zu sagen, wenn man sich anschaut, wie eine Eigentumsdemokratie oder Eigentümerdemokratie realerweise funktionieren wird, dann ist es so, dass die Menschen sehr wahrscheinlich dazu Genötigkeiten werden aufgrund der Umstände letztlich mit dem Vermögen einfach in ihre Aktienpakete zu investieren, so ETF-Indexfonds.
Letztlich, weil nur sehr wenige reale Möglichkeiten haben, wie ein eigenes Unternehmen zu gründen.
Das ist schwierig.
Es gibt einfach nicht so viel Platz für so viele Unternehmen.
Es gibt eher auch diese Platzhirsche an Großunternehmern, die wird es auch in einer...
sehr vielen denkbaren Systemalternativen geben, aufgrund von bestimmten Skaleneffekten usw.
Eine Genossenschaft gründen ist auch nicht einfach.
Da muss man erst mal Mitstreiter finden, andere, die auch die Bereitschaft haben.
Deshalb wird es sehr wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass Leute in Aktien investieren.
Es gibt wenige große Aktienunternehmen einerseits und zugleich wird dann diese Großzeitbevölkerung auch dazu gezwungen sein, Lunarbeit zu verrichten, weil diese Aktienpakete dann doch nicht so viel.
an Dividenden abwerfen, dass man davon wirklich erleben könnte.
Und was, wenn man sich dann anschaut, was aber dann die reale Dynamik innerhalb der Betriebe ist, ist letztlich so, dass innerhalb der Betrieben doch wieder so eine Struktur vorhanden ist, wie wir die aus dem jetzt klassischen Kapitalismus auch schon kennen, dass dort die Lohnarbeiten im Vorort eine relativ anonymen Masse an Aktieninhaberinnen gegenüberstehen.
und diese Aktieninhaberinnen mit ihren Indexfors.
Da schaut man auf sein Aktienpaket und denkt sich auch, wie kann ich das jetzt beurteilen, ob das gut oder schlecht?
Eigentlich habe ich gar keine Kriterien, weil ich kenne die Betriebe gar nicht, weiß nicht, was die produzieren.
Dann schaut mir mal die Dividende an.
Das ist eigentlich die Kennzahl, die Größe, auf die ich zurückgeworfen bin.
Dann werden doch irgendwie sechs Prozent besser sein als fünf Prozent.
Das ungefähr dann die Denklogik.
Und das ist aber dann die Denklogik mit der, die die Lohnarbeiten vor Ort.
konfrontiert sind.
und das absurde bild mit dem man dann zu tun hat ist dann so ein bisschen das sozusagen alle oder die allermeisten subjekte in die gesellschaft immer zugleich in diesen beiden rollen gleichzeitig stecken nämlich in der rolle des akzentenhabers der so ein bisschen schild auf möglichst hohe dividend.
unkleidlich in der Runde des Lohnarbeiten vor Ort, der darunter leiden muss, dass diese Aktionäre aber vor Ort auf maximale Rendite pochen.
Und dann könnte man denken, alle wären so klug sich zu überlegen.
Naja, es ist ja eigentlich doof, was mir hier mein Betrieb vor Ort passiert.
Deshalb werde ich jetzt als Aktieninhaber anders addieren und...
versuchen ethisch korrekt zu investieren.
Das ist aber natürlich vollkommen utopisch und nicht nicht gangbar, weil da sofort massive kollektive Handlungsprobleme entstehen.
Und wenn ich das als Einzelnatur verändert, sich überhaupt nichts, dass ich eine kritische Masse erreiche an Leuten, die dann eine Veränderung erzielt.
Das wird nicht der Fall sein.
Genau.
Zu was es dann kommt und dann ganz kurz noch zu der Pointe mit der Sittlichkeit, ist dann so ein bisschen, dass da wirklich alle sich wechselzeitig zugleich als Aktieninhaber, als sozusagen Kapitaleigentümerinnen und Lohnarbeiter in diesen Rollen gegenseitig ausbeuten.
Und die Part ist so ein bisschen, dass man dann, wenn man nur auf das Ergebnis guckt, auf das Resultat guckt, es geht dann allen eigentlich gleich schlecht bzw.
gleich gut.
Im Ergebnis werden alle so als Aktionäre profitieren als Lohnarbeiten, so ein bisschen leiden unter diese Ausbeutung.
Aber auch was man schauen muss, Hittlichkeit theoretisch ist, was vor Ort passiert mit den Haltungen.
Leute einerseits in diese steife-bornierte Rolle der eigeninteressierten Aktionärinnen getränkt werden und vor Ort in die Rolle der passiven, sozusagen fatalistischen Subjekte, die wiederum ...diktatorischen Management ausgeliefert ist, ...
...dass wiederum gucken muss, ...
...die Aktionäre zu viel hinzustellen hat.
Diese beiden Rollen, ...
...in die wird man dann sozusagen gleichzeitig ...
...reinsozialisiert.
Und das ist Sittlich-Kazirischen-Problem, ...
...wenn man nur auf die Ergebnisse gucken würde ...
...und wenn man nur so ein rein ...
...konsequenzialistisches, ...
...utiliteristisches Kalkül hätte, ...
...dann würde man sagen, ...
...ah, vielleicht ist das Ergebnis irgendwie schön.
Aber nicht, wenn man ...
...sittlich-kazirisch an die ganze Sache rangeht.
Was ja eben auch eine Herangehensweise ist, ...
...die eben fragt, na ja ...
über die ökonomische Sphäre hinaus schaut und eben fragt, na ja, welche Demokratischen Potenziale gibt es denn eigentlich?
Also kann man sich das auch überhaupt wiederum vorstellen?
Das finde ich ja eigentlich wieder interessant, wenn man es so weiter denkt, wenn die Ausbeutung bleibt und wir quasi ganz viel was im Kapitalismus eh geschieht, dann in so einer Form auch noch hätten und die Lorde zum Beispiel wieder sich am Arbeitsplatz also egoistisch verhalten müssen oder ausgebordet werden oder...
Ja, und dann auch wieder so diese Formen von Ressentiments sich entwickeln oder so.
Sollen die dann auch diese eigentlich wiederum egalitäre Eigentümer Demokratie dann aufrechnen?
Sollen die dafür einstehen oder so?
Oder ist es nicht dann, wollen die nicht dann wieder direkt gleich zum richtigen Kapitalismus zeigen?
Das ist ja genau dieser...
So ist die Pente der Analyse.
Es wird eine Erosion der erforderlichen Habitusformen geben und dann fangen die Leute an, auf ihren kleinen Vorteil zu brauchen, auch in der politischen Regulierung.
Dann gibt es natürlich die, die irgendwelche Vorteile haben, quasi Talent oder doch die größere Erbschaft bekommen oder doch den Vorteil zufälligerweise einen riesengroßen Erfolg mit dem eigenen Unternehmen zu haben.
Dann wird natürlich sofort gebrochen, diese Unterschiede, diese Vorteile auch wirklich...
zu vergrößern und politisch im ...
...
doch größere Erfolge umzunehmen.
Ja, das ist total ...
...
die Klassenspannung wird ins eigene Insubekt verschoben.
Ja, genau.
Man hat zwei Hütte auf ...
...
und dann wird deformiert durch die beiden ...
...
Hütte gleichzeitig.
Ich würde gerne die Psychoanalyser ...
...
aus dieser Gesellschaftsform ...
...
mir mal anschauen.
Gut, aber lass uns noch dann ...
...
zu deinem favorisierten Konzept kommen, ...
...
nämlich dem liberalen Sozialismus.
was ja da eine Riesenrolle spielt und vielleicht fangen wir damit auch mal an, ist sozusagen eine Form von Genossenschaft und da beschreibst du das ja auch wieder wunderbar, dass es das auch schon gibt, also auch das ist keine Utopie im Sinne von, da denkt man sich jetzt was ganz Neues aus, sondern es ist ein vereigertes...
für allgemeine das Genossenschaftsmodell.
Vielleicht, ich fand das so interessant.
Ich bin dadurch dadurch noch mal Recherchie zu der Montragon-Genossenschaft der größten der Welt.
Ich glaube, das sieht größte Unternehmen in Spanien und vielleicht kannst du mal erst mal daran zu Beispiel erklären, was heißt denn das eigentlich, wenn du so eine riesige Genossenschaft hättest?
Genau.
Also die Idee ist zu sagen, wenn wir über Alternativen zum Kapitalismus auf betrieblicher Ebene nachdenken, dann sollten wir uns am genossenschaftlichen Modell orientieren.
und Genossenschaft heißt jetzt für mich erstmal, es sind Produktivgenossenschaften, Betriebe, die produktiv agieren, die produzieren Güter- und Dienstleistungen anbieten, aber unter der Maßgabe, dass zumindest ideell Alle Beschäftigten auch Eigentümerinnen des Betriebes sind und Eigentümerinnen nur diejenigen sind, die auch im Betrieb arbeiten.
Das wird hundert Prozent nie genauso aufgehen, aber das ist sozusagen zumindest das regulative Ideal.
und Genossenschaften.
Das hast du schon angesprochen.
Genau das Schöne ist, die gibt es schon, die sind heute auch schon erfolgreich.
Es gibt bestimmte Gründe dafür, warum die sich nicht so einfach in der kapitalistischen Umwelt durchsetzen können, aber es gibt eben auch das Beispiel Montragon.
...
in Spanien zeigt sehr große, sehr erfolgreiche ...
...
Genossenschaften, eben eine siebtgrößte ...
...
Unternehmen in Spanien, das muss man sich einfach ...
...
erst mal so auf der Zunge zerkelen, das ist ...
...
unglaublich großes, unglaublich erfolgreiches.
Unternehmen ist auch total gut durch die ...
...
Wirtschaftskrise gekommen, das ist eine der Vorteile ...
...
von Genossenschaften, dass die einfach ...
...
resilienter sind in Krisen, dass die Leute ...
...
besser zusammenstehen, dass es da so eine ...
...
größere Solidarität gibt.
innerhalb der Betriebe.
Und die Idee wäre zu sagen, in einem liberalen Sozialismus hat jeder das rechnen Betrieb zu gründen.
Also es gibt noch eine Idee von unternehmerischer Freiheit, aber wenn man Betrieb gründet, dann findet es in genossenschaftlicher Form statt.
Also von vornherein unter der Maßgabe, wir machen das hier zusammen, wir sitzen in einem Boot.
Alle sind sozusagen zugleich Beschäftigte und zugleich Mit-Eigentümer.
in der Betriebe.
Da ist dann immer so gleich eine Rückfrage, woher kommt denn eigentlich das Geld?
Aber da knüpfe ich dann sozusagen auf eine sozusagen positive Weise an meine Gegner-Eigentumsdemokratie an.
Ich sage, na, ihr habt doch mit eurer Idee von Eigentümerdemokratie diese sozusagen Schöne.
Vorstellung schöne Idee eines Grunderbes relativ vor Erbschaftssteuern Grunderbe daran künftig an die Leute würden über ein Grunderbe verfügen und die Idee wäre dann zu sagen bestimmter Teil dieses Grunderbes ist sozusagen vor reserviert.
dafür, dass man das als Eigenkapital in den Genossenschaften einsetzt.
Das ist diese Frage der Finanzierung.
und woher haben eigentlich die Leute das Geld?
Das ist tatsächlich eine große Frage, ein großes Problem für die Genossenschaften, wie wir die heute kennen, in unserer kapitalistischen Welt.
Das wäre damit gelöst.
Und es ist dann, vielleicht muss ich das auch wirklich kurz ansprechen, um zu sagen, wo liegen die Herausforderungen und Schwierigkeiten in diesen Modellen, wie es problemorientiert diskutieren.
Weil dann natürlich, es gibt sozusagen so eine normative Vorgabe, die Leute sollen im genossenschaftlichen Betrieb arbeiten und nicht einfach nur als Lohnarbeiterinnen.
Das heißt, es gibt eine bestimmte Anforderung, dann mit Eigenkapital reinzugehen.
Das heißt, alle Menschen sollen sowohl als Arbeitsobjekt bedenken als auch als in der gewissen Weise als Unternehmerinnen oder als Eigentümer innen.
Aber da ist eben siddlichkeitstheoretisch der Punkt zu sagen, Es führt letztlich kein Weg daran vorbei.
Wenn wir uns über alternativen Gedanken machen würden, wenn wir Lohnarbeit in größeren Maße zulassen würden oder die klassische Form von kapitalistischen Betrieben, dann gibt es sofort so Effekte, dass sich das so lawinenartig, schneeweissystemmäßig dann diese Form von Betrieben letztlich durchsetzt, weil die in der kurzen Frist doch starke Konkurrenzvorteile haben und die Genossenschaften dann so nach und nach, auch wenn die für sich genommen sehr produktiv und effizient sind.
doch verdrängt werden würden, weil wir wissen einfach, in einem kapitalistischen Betrieb lassen sich die Menschen doch einfacher und besser ausbeuten und gleichzeitig wird es dann die, den Nachschub an Lohnarbeiten wird es geben, weil es immer genügend Subjekte braucht, die vielleicht doch nicht genügend Eikapital haben und doch angewiesen sind auf Lohnarbeit.
Und da gibt es dann ganz schnell so kaskadenförmige Effekte, dass man am Ende wiederum der Dominanz von kapitalistischen Betrieben hat.
und dann kommt doch wieder, kommen diese ganzen Sittlichkeits.
theoretischen Probleme, die ich analysiere, kommen wieder ins Spiel.
Und dann wäre der Punkt zu sagen, wir als Gesellschaft, als Gemeinwesen insgesamt, haben gute Gründe, uns diese Anforderungen kollektiv aufzulegen.
Wir wollen als Gesellschaft der nossenschaftlichen Betriebe, wir wissen, dass damit bestimmte Bürden mit einhergeht, aber wir haben gute Gründe, die uns selbst aufzulegen und die werden auch.
Abgemildert durch bestimmte Maßnahmen, wie eben dieses Grund erinnert, ist es nicht so, dass jeder das wirklich aus ganz eigener privater Tasche, da diese Genossenschaftsanteile finanzieren müsste.
So ungefähr ist es gedacht.
Ich frage nochmal den Interview-Partner zurück.
Ich finde sie in der linken.
Interessant.
Wir müssen vielleicht auch noch mal kurz diese Frage ansprechen.
Warum keine radikalere Alternative?
Das ist mir in linken Diskussionskontexten öfter begegnet.
Ich weiß nicht, ob du das auch noch später ansprechen wolltest oder wie so deine...
Das liegt vielleicht auch daran, dass die Nähe zu einem liberalen Sozialismus und der Idee, was Jacobin macht, da sind wir ja schon relativ nahe.
Niemand, der nochmal für, weiß ich nicht, also einen Staatsozialismus plädieren würde.
Aber du hast natürlich recht, ja.
Also sag gerne, das ist jetzt total die Rollenverschiebung.
Jetzt hast du die Frage gestellt.
Ich gebe es einfach an dich weiter.
Ja, ja.
Es ist wirklich interessant, weil ich zumindest in bestimmten Milieus und Frankfurt und Berlin, ist man schon damit konfrontiert.
Es ist noch nicht der Kommunismus.
Es ist auch nicht die radikal demokratische, vollständige Planung des Wirtschaftserlebens.
Das ist ja dann auch die Alternative, die Menschen da vor Augen haben.
Weil liberaler Sozialismus heißt schon, es gibt genossenschaftliche Betriebe, aber es gibt ansonsten eine Marktvermittlung des wirtschaftlichen Handels.
Also die Betriebe bieten ihre...
Waren auf dem Markt an.
Es gibt auch bestimmte Formen von Konkurrenzverhältnissen, in dem Sinn wird schon am Markt festgehalten.
Und ich glaube, das ist schon gut, das nochmal in der Weise explizit anzusprechen, weil da ist für viele Linke, ist so ein bisschen gezogen, ist so ein rotes Hoch, was du akzitierst im Markt, auch in einer Form.
Und da muss man schon sagen, ich bin da sehr offen allen Überlegungen gegenüber, wo es um Weitergehende Reformen geht, eine Idee von demokratischer Planung des Wirtschaftens geht.
Aber ich spiele dann immer relativ schnell den Ball zurück und sage, ihr aus dem Lager der Befürworter in den demokratischen Wirtschaftsplanung müsst dann erst mal sehr viel sagen und sehr viel liefern, was ihr genau damit meint, wie das genau funktionieren soll und wie ihr vor allem mit den Bedenken umgehen soll wollt, die aus liberaler.
Richtung ja zu Recht existieren, dass so eine Form der Planung letztlich immer in der Gefahr steht, selbst wenn sie basisdemokratisch organisiert ist, am Ende doch wieder auf eine sehr starke Zentralisierung von wirtschaftlicher Planung rauszulaufen, dass dann am Ende plötzlich doch wieder so eine Bürokratenklasse an Planern da ist, die sehr, sehr viel Macht hat und so eine Tendenz haben, sich selbst zu reproduzieren und sich selbst zu verstärken.
Das ist ein bisschen die Kritik und ich glaube, da muss man schon wirklich sehr explizit sagen.
Der Markt hat als Markt wirklich viele problematische Seiten.
Das finde ich, also muss man auch wirklich ganz ganz klar sagen.
Also selbst wenn ich auf der einen Seite sage, es gibt gute Gründe für einen liberalen Sozialismus, für einen Marktsozialismus heißt es nicht, dass man deshalb dann blauäugig wird und den Markt nur schön redet.
Auch der Markt, auch in dem liberalen Sozialismus wird eine problematische Institution bleiben.
Es heißt aber gleichzeitig, dass wenn wir über Systemalternativen nachdenken, die darüber hinausgehen, irgendwie in Richtung...
demokratische Wirtschaftsplanung, da muss diese Seite erstmal liefern und wirklich im Detail, zumindest im hinreichenden Detail nachweisen, da wird es keine Probleme geben, also nicht die, die sozusagen absehbaren Probleme geben, die wir heute eigentlich, von denen wir heute eigentlich schon wissen.
Ich meine, das ist sozusagen wirklich das Buch, weshalb ich das auch allen...
Leuten empfehlen würde die sozusagen stärker von der sozialistischen Tradition herkommen ist.
was mich wirklich berührt hat auch ist wie ernst du den liberalismus doch nimmst sozusagen in seiner auch seiner ganzen Theorie Tradition und so weiter.
und ich finde das ist ja was woran.
Du zeigst es eigentlich das sowohl die sozialistische Tradition als auch die liberaler gerade in der Philosophie gewissermaßen so ein bisschen aufeinander.
zugehen können, ganz zurecht, weil den Liberalen oft die ökonomische Kritik fehlt oder die materialistische und andersrum die Sozialisten ja doch ganz viel auch lernen können.
Davon war es eine gut.
Freiheitsrechte.
Es ist eigentlich auch bei Marx natürlich schon da gewesen, dass man sagt, man kann jetzt nicht über die Hinter die Werte der Französischen Revolution zurückfallen, aber dass man das auch wieder...
ernster nimmt.
Also das finde ich, fand ich total erfrischend tatsächlich.
Ja, genau.
Und das ist auch einfach rhetorisch so ein schöner Move, zu sagen, mit dem liberalen Sozialismus.
Da schreckt man so ein bisschen auf und man irritiert so ein bisschen, provoziert so ein bisschen.
Gleichzeitig ist es aber auch so ein Türöffner, wenn man sagen kann, Leute, es gibt nicht nur den autoritären Staatssozialismus, sondern es gibt einen genuinen liberalen Sozialismus.
Und in dem Sinne kann man dann erstmal Leute aus der Mitte oder aus den liberalen Strömungen doch so ein bisschen abholen.
irgendwie ins Gespräch kommen und gegenüber linken Theorieströmungen kann man schon nochmal deutlicher machen, dass es wirklich wichtig ist darüber nachzudenken, über Freiheit nicht nur als Größe des Kollektivs oder des Gemeinwesens, das ist natürlich auch richtig, sondern Freiheit, das Individuum ist ganz, ganz stark zu machen, auch über so Dinge nachzudenken wie...
bestimmte liberale Grundrechte, deren Bedeutung nachzudenken, Rechtsstaatlichkeit.
Das sind alles Dinge, wo es so eine linke Kritik gibt, die oft so ein bisschen das Kind mit dem Bader ausschüttelt, also sozusagen eine berechtliche Kritik hat, aber dann allzu schnell sagt, wir wischen jetzt, wir wischen es insgesamt vom Tisch und dann haben wir es erledigt.
Und das ist problematisch.
Man muss da wirklich so in der Modus der Aufhebung denken.
Also man kritisiert bestimmte Aspekte und versucht aber bestimmte Aspekte.
auch zu erhalten.
Liberalismus, ganz kurz noch ein Stichwort, gerade was die, sozusagen linke Gesprächsparte darin betrifft.
Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig.
Das habe ich auch wirklich von Rawls erst so richtig gelernt.
Er heißt auch eine Idee von Wertepluralismus anzuerkennen, dass wir nicht nur von ausgehen können, dass wir eine Gesellschaft wünschen wollen könnten, in der alle wirklich hundert Prozent überzeugte Kommunistinnen und Sozialistinnen wären, sondern wir müssen davon ausgehen, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Wertehaltungen und wir müssen auf Basis dieser zum Teil sehr konflikierenden Wertehaltungen versuchen, ins Gespräch zu kommen und dann von der Idee von Demokratie und Gerechtigkeit herzukommen und dann kommt Sozialismus eher als indirekter.
wird in Schwier.
So ist es ja auch dann ganz wesentlich im Buch gedacht.
Sozialismus heißt da nicht eine bestimmte Form von sozialer Freiheit oder eine bestimmte Idee von Gemeinschaft, sondern Sozialismus heißt erst mal nur im relativ engen Sinne kollektive Verfügung über Produktionsmittel, aber nicht als Selbstzweck und als Wert an sich, sondern nur als notwendige Bedingung dafür, um sowas wie demokratische Gerechtigkeit zu verwirklichen.
So ist es gedacht und in dem Sinne ist es wirklich ein Genuinen.
liberaler Gedanke, weil liberalismus die jetzt dann auch von der Idee von Gerechtigkeit oder Demokratie.
abweichen oder abfallen würde, wäre kein ernsthafter, kein ernst zu nehmen mit dem Liberalismus.
Genau, aber wenn man sozusagen beide Strömungen ernst mit Liberalismus und Sozialismus, dann finde ich, genau, es ist schon mehr als eine rhetorische, sozusagen Finesse in dem Blutbuch zu sagen, dass diese beiden Strömungen wirklich aufeinander angewiesen sind oder aufeinander zu laufen.
So ist es schon ganz ernsthaft gemeint.
Ja, und ich meine gut, ich meine sozusagen, jetzt haben wir ein bisschen schon die Endporente vorweggenommen, aber nochmal auch der liberale Sozialismus jetzt aus einer wirtschaftlichen Perspektive, was ich interessant fand.
Also sind nicht genau diese, weil das ist ja genau das, was ihn dann von der Eigentümer schwächer macht, auch als die Eigentümer Demokratie könnte sein.
Ja gut, da ist es aber trotzdem nicht so effizient oder es ist eine Art von, die Konkurrenz wird auch rausgenommen und so weiter.
Also wie würdest du diesem Problem da begegnen?
Ja.
An der Stelle muss man, glaube ich, zwei Dinge sagen.
Man muss einerseits sagen, damit der Effizienz ist es nicht so dramatisch nach allem, was wir wissen.
Und das Gute ist ja auch, wir können heute schon genossenschaftliche Betriebe untersuchen.
Wir haben heute schon bestimmte Formen der Transformation von Konkurrenzverhältnissen, zum Beispiel bei Tarifverträgen oder wenn sich Ärztinnen und Ärzte kann man organisieren oder Rechtsanwälte in Anwaltskammern.
Das sind auch bestimmte Weisen, wie man Konkurrenzverhältnisse sozial transformieren kann.
und dann sieht man ja, das funktioniert immer noch in einer produktiven Effizienz stark an den Hin sich ziemlich gut, aber andererseits werden die Verhältnisse auch eine ethische Weise positiv transformiert.
Also in dem Sinn mit den Effizienzproblemen ist es nicht so dramatisch und nicht so schlimm, wie oft dargestellt wird.
Ich würde aber trotzdem sagen, wahrscheinlich muss man anerkennen, dass es bestimmte leichte Effizienznachteile gibt bei genossenschaftlichen Betrieben zumal auch noch sozusagen ja diese Konkurrenzbeziehung noch in bestimmte Weise transformiert sein sollen.
Aber man muss eben das Gesamtbild in den Üblichen nehmen.
Es geht darum, Wirtschaft nicht nur als diesen Effizienzmotor zu betrachten, sondern unter diesem größeren zittlichkeitstheoretischen Blickwinkel, bei dem Effizienz natürlich ein wichtiger Wert ist, weil Effizienz heißt...
Heißt ja tatsächlich, wir backen ein möglichst großen Kuchen, wir wollen ja ein möglichst hohen Lebensstandard, das ist ja gar nicht zu gestreiten, aber das ist ein Wert.
Das ist ja auch tatsächlich zu einer Akzeptanz von einem politischen System.
Absolut, genau.
Nur ist eben ein Wert unter vielen anderen Werten.
und zittlichkeitstheoretisch heißt dann eben die Porante zu sagen, wir müssen vor allem nach den Bedingungen eines gelingenden demokratischen Gemeinwesens schauen und schauen, wie die Wirtschaft organisiert ist und diese Bedingungen sicherzustellen.
und wenn, das heißt, dass wir dann in der Organisation der Betriebe leichte Effizienz nachteile.
und kauf nehmen müssen, dann ist es so.
Gesetz dem Fall, dass die nicht so stark sind, aber da kann bisher große Evidenz dafür, die werden nicht so stark sind, die werden akzeptabel sein.
Aber ich bin da auch ganz pragmatisch.
Also es geht jetzt nicht darum, am Schreibtisch sozusagen so eine letztgültige Vision zu entwickeln, die man dann nur umsetzen muss, sondern es ist schon eher auf so ein Trial-and-Error-Gedanke.
Es ist sozusagen erstmal eine Systemalternative, mit der fangen wir kleinschrittig an, versuchen dann die in größeren Maße umzusetzen, dann guckt man mal, wie es funktioniert.
Wenn es nicht so gut funktioniert, muss man sich entge- über radikale Reformen Gedanken machen oder über irgendwie so ein Mischsystem in Richtung eigenen Demokratie oder liberaler Sozialismus gemischt.
Je nachdem.
So ist es gedacht, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, diese Effizienzkartik, die ist nicht so stark, wie die oft dargestellt wird.
Und man muss eben das zicklich-katzeerische Gesamtbild immer im Blick haben.
vielleicht noch eine letzte Frage, die so ein bisschen ja, vielleicht kätzlerisch ist, ich weiß es nicht, aber ich meine, wir leben jetzt gerade wirklich in der Zeit, wo man sagen muss, also seitdem ich über den Sozialismus nachdenke, ist es eigentlich immer schlimmer geworden sozusagen, der neue Faschismus steht quasi vor der Tür, die Linke liegt weltweit eigentlich, historisch wahrscheinlich, ist es am Boden, ja, und wir am gleichzeitig, würde ich sagen, keiner.
Wenn ich jetzt über meinen Studium nachdenke oder so gleich würde ich nie sagen naja das war jetzt irgendwie quatsch sich mit Sozialismus oder so zu beschäftigen.
gleichzeitig sieht man ja es braucht eigentlich eine Art von Einhegung, Transformation, Deskapitalismus um genau all diese riesigen Probleme, soziale Ungleichheit, Klimakatastrophaschismus zu lösen.
ja und deswegen ist dein Buch auch so wichtig weil es halt eben mal aufzeit ja gut in diese Richtung könnte es gehen.
aber siehst du gerade irgendwo sozusagen auch einen aktör oder sozusagen die irgendwie auf höhe der zeit wirklich politik macht?
oder sind auch, wie soll ich sagen, es könnte ja noch schlimmer sein, sind die Beharrungskräfte oder die Mächte zu stark, dass sich solche Akteure überhaupt durchsetzen können.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage.
Ich habe die im Buch relativ weitgehend ausgespart, weil die Frage nach Transformation oder nach dem Weg von hier nach dort ist nochmal eine riesengroße Frage und ich fand wichtig, vom anderen Ende her zu denken, von der realistischen Utopie her zu denken und von dort aus zu fragen, wie könnten wir eigentlich dahin kommen, gesetzt den Fall, dass es eine...
gute vernünftige Utopies, die wir da vor Augen haben.
Aber die Frage stellt sich natürlich trotzdem.
Und eine abstrakte Antwort auf die Frage lautet Die Verhältnisse sind ständig im Fluss.
Wir haben so viele Veränderungen erlebt, die überhaupt nicht vorhersehbar waren.
Also wer hätte sich vor der Finanzkrise jemals ausdenken können, dass die Weltwirtschaftskrise, dass die Finanzkrise kommen wird, wer hätte sich davor jemals ausdenken können, dass jemand wie Bernie Sanders in den USA so starrt, hat eine beinahe Präsident- schafskandidat, die hat Demokratinnen geworden, dass jemand wie Corbyn in den, in, in, in Großbritannien dermaßen starrt.
Es wäre vollkommen unmöglich gewesen, sich das vorzustellen.
Die Leute werden starrt zurück.
leert worden, oder?
So ist es doch.
Also deshalb, die Dinge sind sehr veränderbar.
Also die Antwort wäre, man muss nur auf die nächste Krise behalten, den Umschwung, der Stimmung, der Mehrheit.
Dann muss man aber schon auch noch mehr machen.
Dann muss man schon schon die Rezepte wirklich sozusagen aus der Tasche zaubern können.
Und so dafür ist es ja auch gedacht, dass in einem bestimmten Punkt der Krise, wenn die Mehrheiten und auch die normativen Hegemonien so offen sind, dafür sich zu verändern, dass man dann aber auch noch mal mehr bieten kann, dass man dann Substanz liefern kann.
Das ist so die abstraktere Antwort, die konkretere Antwort, an der ich jetzt in den letzten Monaten, in den letzten Jahr arbeite, ist eine Arbeit an einem unabhängigen Institut, Institut für Wirtschafts-, für Unternehmensdemokratie, Entschuldigung, Institut für Unternehmensdemokratie, bei der wir nach sehr pragmatischen Wegen suchen, durch die Betriebe in Genossenschaften umgewandelt werden können.
Und wir gehen da vor allem von der Situation aus, die soziologisch einfach zutreffend ist, aber überraschend ist, dass ja, vor allem in Deutschland, aber auch in anderen Wirtschaften, in Westen, ein sehr großer Teil der Wirtschaft doch in kleinen und mittelständischen Unternehmen organisiert ist.
Und viele dieser Unternehmen tatsächlich innerhalb der eigenen Familie keine Nachfolge.
ihnen finden, was viele Linke glaube ich gar nicht so vor Augen haben, aber es ist der Fall, es ist soziologisch einfach der Fall und dann kann man so ein bisschen am Interesse der alten Eigentümer anknüpfen, dass der Betrieb ja erhalten bleiben soll.
Die haben keine Lust darauf, diesen Betrieb wirklich dicht zu machen und die haben auch oft wenig Lust darauf, den an die große Konkurrenz zu verkaufen, weil das heißt, der Betrieb wird aufgelöst, der Name geht verloren, der Standort geht verloren, die Identität des Betriebs geht verloren.
Und dann liegt das eigentlich nahe.
Nein, du darfst nicht ironisch.
Nein, ich lache gar nicht ironisch, weil ich lache und das ist für dich so eine wirklich...
Die Liste der Geschichte, das ist auch einmal das demografische Problem, quasi uns, quasi das Eigen, das ist wunderbar.
Es ist soziologisch wirklich.
Es ist eine Tatsache, die lässt sich so beobachten.
Und in England?
Nee, in England gibt es diese Form der Übernahmen, die wir vor Augen haben, mit den Employee Ownershire Trust.
Seit Jahrzehnten ist diese Form der Übernahme, ist dort eingeführt.
Das ist dort aber eine Trustform.
Das ist nicht wirklich demokratisch, aber es ist schon ziemlich weiter weg in die Richtungen, die wir auch gehen wollen.
Wir haben eine demokratische Genossenschaft vor Augen.
als Nachfolgefirma, also die alte Eigentümer verkauft dann an die Belegschaft.
Aber in England gibt es ein Modell, wo das auch steuerlich gefördert wird.
Und es ist dort ein unglaublicher Erfolg.
Und das sind genau die Argumente, die ich jetzt gebracht habe, die dort sozusagen die alte Eigentümerklasse davon überzeugt, wie die Betriebe in die Hände.
der Beschäftigten zu legen.
Und es ist dann auch diese ganzen Zittlichkeitsargumente, die ich jetzt gebracht habe, finden sich dort auf kleinerer Ebene.
Die alten Algorithmen fangen an, anders zu denken.
Die Beschäftigten fangen an, anders zu denken.
Es ist wirklich interessant.
Und die Hoffnung wäre, dass man da so ein bisschen so klein schrittlich in die richtige Richtung geht.
Und dass man dann sagen kann, ab einem bestimmten Punkt mehr, hört doch mal her, wir haben doch jetzt zehn Prozent.
der Wirtschaft eh schon auf diese irgendwie kollektive Weise organisiert und es funktioniert doch ganz gut, dann kann man doch darauf aufbauen, weitergehen.
So ist die Idee.
Das ist wunderbar.
Ich finde, das ist wirklich ein hoffnungsvolles Schlusswort.
Das habe ich selten hier in letzter Zeit bei Jackup and Talks.
Also vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ich kann die Lektüre wirklich empfehlen, obwohl es ein Philosophiesbuch ist, ist es wirklich gut zu lesen.
Und ich weiß, ich sage das häufig, aber in dem Fall ist es wirklich sehr gut zu lesen.
Und ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, wisst ihr, was ihr tun müsst, liken, abonnieren.
Teilen, ich weise noch mal darauf hin, kauft euch gerne ein Abo von der neuen Ausgabe über jacko-bin.de.
Talks, damit unterstützt ihr dieses Format und helft, das es uns weiter gibt.